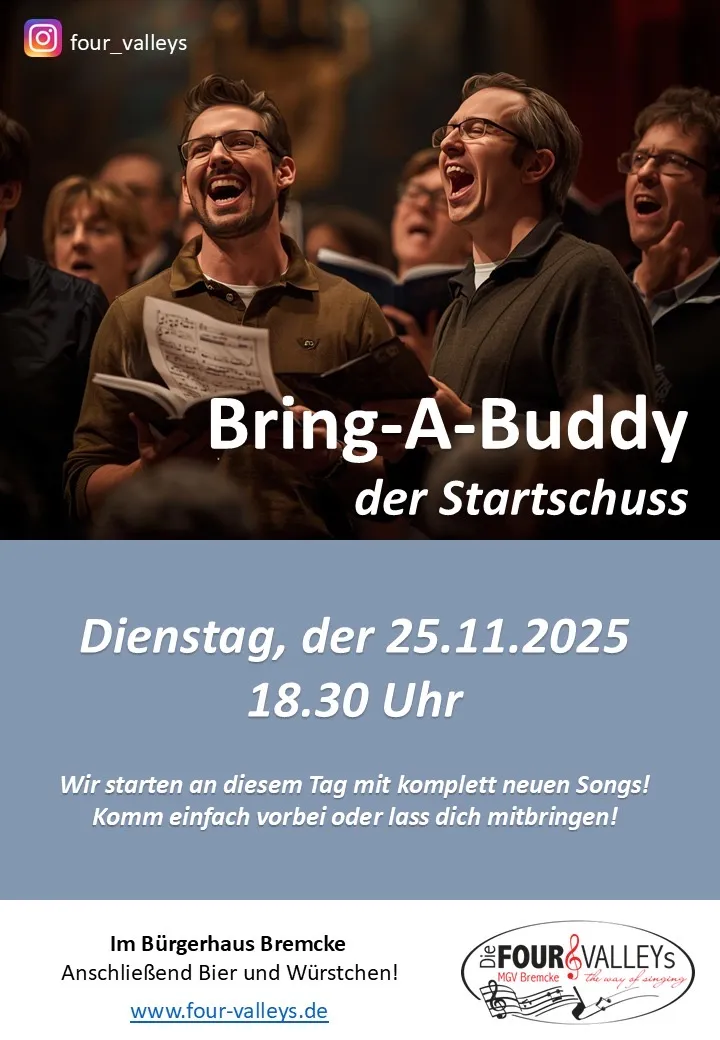Sage niemand, es sei nicht gewarnt worden. Sage keiner, das Fichtensterben im Sauerland komme aus heiterem Himmel. Und möge nie der Stoßseufzer laut werden, das habe man nun wirklich nicht vorausahnen können. An dieser Stelle sei es laut vorgetragen: Die Warnung vor der nun eingetretenen Zerstörung unserer Wälder ist seit 1947 in der DNA der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald niedergeschrieben.
Die Prognose, dass die Fichtenplantagen unsere Heimatwälder zugrunde richten werden, stammt von Förster, Ur-SGVer und Mitbegründer der Waldschutz-Organisation Wilhelm Münker (*1874, + 1970) aus Hilchenbach; seine Erkenntnisse ließen ihn Leiter des Ausschusses zur Rettung des Laubwaldes werden. Münkers Mahnungen gegen die Verfichtung, die dadurch ausgelöste Versauerung des Bodens und die Verschlechterung des Wasserhaushaltes sind heute, ein Dreivierteljahrhundert später, aktueller denn je. Im Arnsberger Wald wird nach dem Fichtensterben der letzten Jahre die Totalumkehr versucht. Für Rothaargebirge und Ebbegebirge gilt: Von Münker und Arnsberg lernen, könnte heißen, unsere Wälder wiederzubeleben, unsere Heimat ökologisch zu retten.

Wilhelm Münker 1947: Die Fichtenplantagen werden zu unserem Schicksal
Wilhelm Münker, er wurde 95 Jahre alt, ist einer der ganz frühen Umweltbewegten. Bereits 1903 wurde er Vorsitzender der SGV-Ortsgruppe Hilchenbach, kaufte 1911 auf eigene Kosten eine Fläche zu deren Schutz auf, war 1947 Gründungsmitglied der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Verfasser der vielbeachteten, aber wenig beherzten Denkschrift „Dem Mischwald gehört die Zukunft“ und war Gründer der Wilhelm-Münker-Stiftung für Gesundheit, Wandern, Naturschutz und Heimatpflege.
Münker wies kundig darauf hin, dass Fichtenplantagen zur Versiegelung und Härtung des Waldbodens führten, einer tiefgehenden Austrocknung und Versauerung des Bodens Vorschub leisteten, die Baumart untypisch und klimatisch ungeeignet sei und sie von enormer Schädlingsanfälligkeit bedroht werde. Er prognostizierte folgenden Generationen das großflächige Abstreben der Fichten-Monokulturen und dem Waldboden einen langandauernden Schaden. Wer heute unsere abgeholzten Berghänge betrachtet, muss einräumen, dass Münker weit vorausschauend war, auch wenn er den Klimawandel und dessen Folgen als ergänzende und verheerende Bedrohung nicht erahnte.

Geograph Carsten Rocholl: Arnsberger Wald, Ebbe- und Rothaargebirge im globalen Kontext
Ausgerichtet durch die BUND-Kreisgruppe Soest hat soeben eine Reihe von Veranstaltungen rund um den Arnsberger Wald begonnen, die auch auf Rothaar- und Ebbegebirge ausstrahlen. Carsten Rocholl, diplomierter Geograph, Aktiver im Bund für Umwelt und Naturschutz, aktiv für die Grünen auf Orts- und Landesebene, eröffnete die bis auf den letzten Platz besetzte Pilotveranstaltung in Körbecke am Möhnesee: „Der Wald kleidet sich nach der Dürre und dem Borkenkäfer neu. Unsere Reihe wird von den verschiedensten Anbietern rund um den Wald gestaltet.“ Dieser erste Abend war mit einem hochkarätigen Sprecherquartett aus Fachleuten besetzt, die die Kalamität von Arnsberger Wald – und damit unseren Mittelgebirgen – in den globalen und überörtlichen Bezug setzten.

BUND-Sprecher Dr. Thomas Henningsen: Am Amazonas sieht‘s so elend aus wie im Sauerland
Dr. Thomas Henningsen, internationaler Kampagnendirektor von Greenpeace, nahm den Platz der Kassandra ein. „Alle zwei Sekunden vernichten wir auf dieser Welt ein Fußballfeld Wald.“ Er zeigte erschreckende Bilder von vernichtetem Urwald - wer nicht ganz genau hinsah, der wähnte das Sauerland nach der Dürre zu erkennen. Wie die Bilder sich gleichen! Der Wald sei weltweit drei Bedrohungslagen ausgesetzt: 1. Abholzung und Brandrodung, 2. Vordringen der Landwirtschaft zur Sojaproduktion und Fleischerzeugung, 3. Klimawandel. Henningsens Weckruf: Es ist keine Zeit mehr zu verlieren!
Fotogalerie
Forstamtsleiter Olaf Ikenmeyer: Ohne Wasser geht gar nichts
Einer Lage von der Front glich der Bericht des Leiters des Regionalforstamtes Arnsberger Wald, Olaf Ikenmeyer. Er trat auf vor einem weit ins Land schauenden Lichtbild, das eine völlig zerstörte Waldfläche zeigte. Was tun? Deprimiert sein und sich abwenden? Oder Aktivismus um jeden Preis zeigen? Ikenmeyer berichtete von der Zeit nach Kyrill, der ersten richtig großen Kalamität in unserem Mittelgebirge: „Wir haben damals 280 Hektar ohne gelenkte Wiederbewaldung belassen.“ Sprich: Man hoffte, einen neuen Wald, einen natürlichen Wald zu bekommen, wenn man die Notflächen sich selbst überlasse. Das Ergebnis: ernüchternd. „Wir haben alles, aber keinen gesunden Mischwald bekommen. Gewachsen ist eine Dickung aus Fichte, Birke, Lärche und Douglasie.“ Ikenmeyers Fazit: „Nichstun hilft nicht.“ Aus dem Kyrill-Experiment wisse man, dass sich bereits jetzt auf den aktuell abgeholzten Borkenkäferflächen ein Vorwald bilde. „Das Zeitfenster der Freiflächen schließt sich.“
Also, was tun? Alle toten Reste im Wald lassen oder alles Trockene wegräumen, die Stümpfe entnehmen? „Die verbleibenden Stümpfe lassen wir im Wald. Trockene Fichten, die noch da sind, führen zu geringerer Verdunstung und mehr Bodenfeuchte. Und die Stümpfe sind eine Barriere gegen Wild und Verbiss der Setzlinge.“
Fotogalerie
Wie soll der neue Wald aussehen? Olaf Ikenmeyer befürwortet die Anlage eines „vielgestaltigen Mischwaldes“; gewünscht sind u.a. Buche, Esche, Linde, Vogelbeere mit Einsprenkeln von Nadelbäumen. Alles aber steht unter der Vorbehalt, dass Feuchte vorhanden ist. „Das Wasser muss in der Fläche bleiben. Unser zentrales Thema beim Waldwiederaufbau ist das Wasser.“
Im Layout des Waldes sollten Buschränder an den Wegen vorgesehen werden: „Drei Meter Buschrand, dann erst der Wald.“ Jetzt bestehe die einmalige Chance für den Waldumbau – ein Mischwald, eine Wiedervernässung von Flächen, ein neues Layout. „Setzen wir aber erneut auf Nadelwald, dann sind wir in 20 Jahren wieder genau da, wo wir heute sind.“ Ikenmeyer rief dazu auf, den Waldwiederaufbau mutig anzugehen und in einem großen gesellschaftlichen Kontext, unter Einbeziehung von Schulen und Vereinen, die Ärmel aufzukrempeln: „Machen ist wie heulen, nur geiler. Und klug zu reden ist das eine, anzupacken das andere.“ Aufgerüttelt und spontan sagten anwesende Lehrer zu, ihre Klassen zu Waldarbeitstagen zu motivieren und gemeinsam mit dem Regionalforstamt anzugreifen.

Landschaftsplaner Hans-Joachim Berger: Die Fichte sorgt selbst für Austrocknung
Landschaftsplaner Hans-Joachim Berger stellte das Modell eines „Schwammwaldes“ vor. Dazu leitete er einen direkten Zusammenhang zwischen den immer häufiger eintretenden schweren Hochwässern im Winterhalbjahr, Niederigwässern im Sommer, dem Fortschwemmen von Sediment sowie der Boden- und Tiefenerosion her. „Das Feinsubstrat aus den Böden wird vom Starkregen mitgerissen; nur das Grobsubstrat bleibt in den Waldböden.“ Hohlwege und Seitengräben neben Waldwegen wirkten wie Kanäle. Hinzu kämen Entwässerungsgräben, „Spurgleise“ für Holz-Erntemaschinen und Rückegassen.
„Der moderne Wegebau ist ein System von entwässernden Linien.“ Im Arnsberger Wald komme man auf 500 Kilometer Gräben oder grabenähnliche Linien. Man sehe in Bächen und Linien das Wasser abfließen, während auf einer feuchten Fläche das Wasser unbemerkt riesele oder sickere. „Wir brauchen eine Wiederetablierung der Auen, eine Verfüllung der direkten, neu angelegten Bäche. Ein intakter Wald bedeutet Hochwasserschutz!“
Fotogalerie
Um jedoch die Entwässerungsgräben zu schließen, mangele es an Material, an verfügbarem Boden. Berger schlug vor, abgestorbene Baumstämme in die Gräben zu werfen und Abraum der Waldernte dazu zu kippen.
Ein ganz schlechtes Zeugnis stellte er dem Baumtyp Fichte aus - man meinte in diesem Moment, Wilhelm Münker zu hören: Die Fichte trockne ihren Standort selbst aus. Das Immergrün schirme den Boden gegen Regen ab, bewirke auch im Winter Verdunstung. Es gebe keinen Laub- und Reisigfall, weswegen der Waldboden in Fichtenbeständen kahl und verarmt sei. Bachläufe in Fichtenplantagen schnitten sich tief in den Boden ein, während die in Mischbeständen auf Niveau blieben. Diese Erkenntnisse aus dem Arnsberger Wald seien direkt auf Ebbe- und Rothaargebirge, eigentlich auf alle Mittelgebirge, übertragbar.

Abgeordneter Dr. Gregor Kaiser: Nie wieder Kahlschläge!
Dr. Gregor Kaiser aus Lennestadt, Landtagsabgeordneter und waldpolitischer Sprecher der grünen Fraktion, fasste die Pläne zusammen: „Das Ziel sind multifunktionale Wälder, die nicht komplett genutzt werden. Wir brauchen Dauerwald-Bestände mit verschiedenen Generationen. Daraus sollen Einzelbaum-Entnahmen stattfinden, nie Kahlschläge.“
Mehr zum Thema: So sieht es bei einem großen Privatwaldbesitzer aus