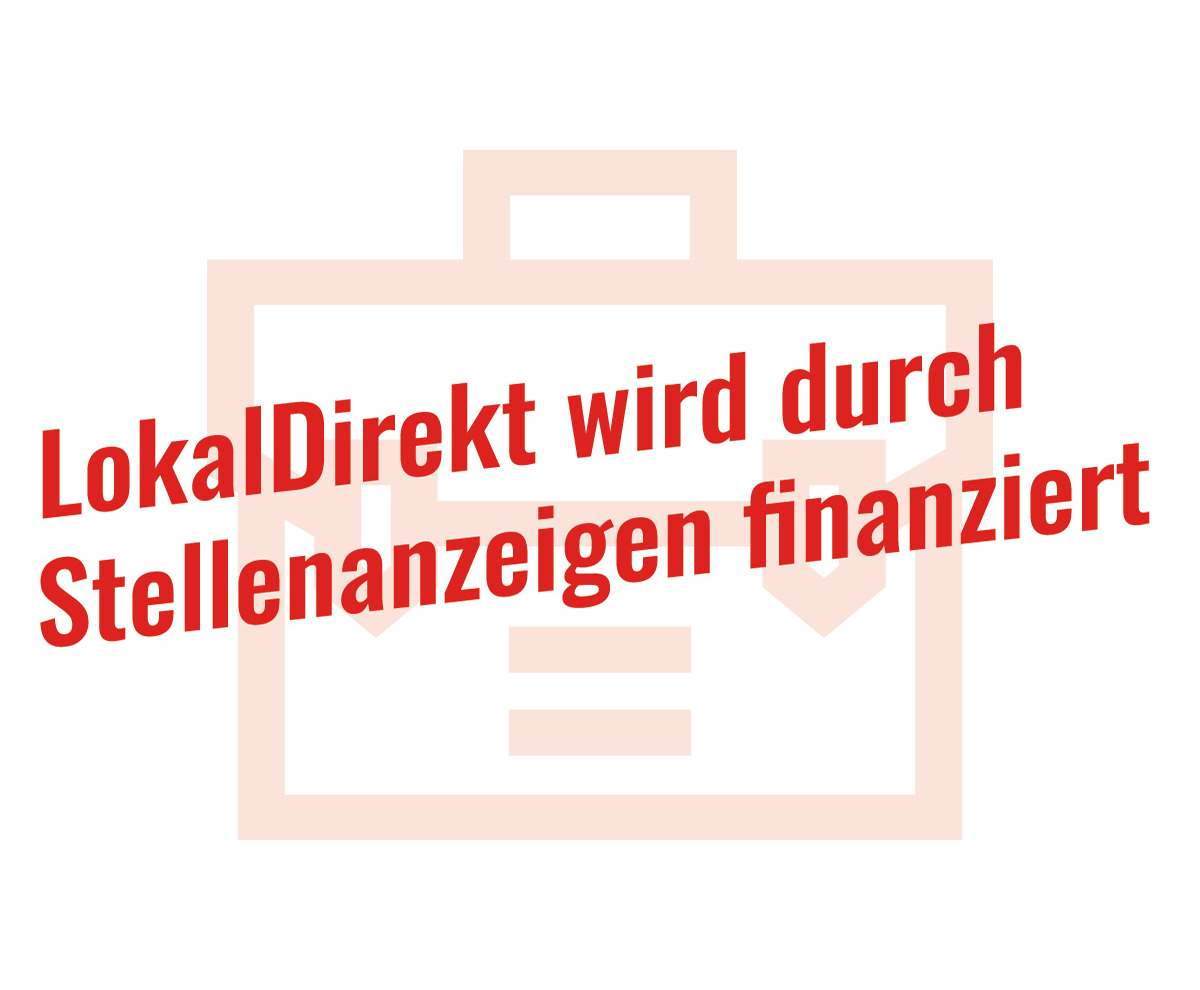Gerne wird der queeren Szene vorgeworfen, sie sei äußerlich und grell, sei zu aufmerksamkeitsheischend. Die gegenwärtig laufende Ausstellung zum „Rosa Winkel“, die die Verfolgung Homosexueller im Dritten Reich zum Thema hat, ausgerichtet von den Vereinen Gedenkzellen und CSD Lüdenscheid, überzeugt indes durch Tiefe und Gründlichkeit. Wir berichten über zwei außergewöhnliche Kinoabende im Verlauf der Ausstellungswochen.
Vor "Hulda am Markt" in Lüdenscheid steht mit "Onkel Willi" die Lieblingsfigur der Stadtbevölkerung. Untersetzter älterer Herr, akkurat geschlossener Mantel, Hut mit Krempe, Zigarre auf der Hand. Ein Sympath, dieser Willi. - Wenige Schritte vom Sternplatz erwacht am Mittwoch, 22. Oktober, auf der Leinwand in der Begegnungskneipe Frieda's in der Oberstadt ein ganz anderer Onkel Willi zu filmischem Leben, der aber der Broncefigur von Waldemar Wien zum Verwechseln ähnlich sieht. Es ist Wilhelm Heckmann, der anverwandte Onkel Willi des Dokumentarfilmers Klaus Stanjek. Einen Tag später wird Stanjek seinen Film über Onkel Willi im Apollo-Service-Kino Altena ein zweites Mal aufführen.

"Klänge des Verschweigens" ist ein detektivischer Film über das Schicksal des in Altena gebürtigen Musikers Wilhelm Heckmann, der unter dem Brandmal des "rosa Winkels" als Homosexueller acht Jahre in den Konzentrationslagern Dachau (Bayern) und Österreich eingesperrt war, gequält wurde. Der nur überlebte, weil er als Mitglied der KZ-Kapelle für Lagerleitung und Wachpersonal musizierte, der "der Mann mit dem Akkordeon war". Es ist ein Film über das vermeintliche Nichtwissen im Dritten Reich und das systematische Verschweigen der Verbrechen der Nazis nach dem Krieg bis weit hinein ins 21. Jahrtausend.
Uraufgeführt 2012, ist "Klänge des Verschweigens" wohl "der" Film, der das Schicksal der Homosexuellen im Dritten Reich am besten aufarbeitet. Dokumentarfilmer Klaus Stanjek wurde für sein Werk mit erstklassigen Preisen der Filmkunst ausgezeichnet. Die beiden Vorführungen in Lüdenscheid und Altena wurden vom Verein Gedenkzellen und dem CSD-Verein Lüdenscheid organisiert, stehen in Zusammenhang mit der aktuellen Ausstellung "Rosa Winkel" in den Museen der Kreisstadt und stießen auf reges Interesse. Besondere Brisanz kam der Aufführung in Willi Heckmanns Geburtsstadt Altena zu, weil der Film nach einer Reise durch halb Europa tatsächlich erstmals in der Burgstadt gezeigt wurde und weil er in sich Interviews seinerzeit noch lebender Altenaer birgt, die zu dem Bürger und Musiker Wilhelm Heckmann befragt wurden.
Das Apollo-Service-Kino steht in der Nette, wird als Inselgebäude umströmt vom Verkehr. Es steht in einem von Verfall, ja Zerfall geprägten Ortsteil und es ist in der gewesenen Kreisstadt (der Kreis Altena bestand bis 1968), ein wirklicher, ein positiver Ausnahmebau. Gepflegt, farbig leuchtend, illuminiert von reichlich Licht, überstrahlt es an dem verregneten Donnerstag die architektonische Not der Umgebung. Der Kinosaal im ersten Obergeschoss präsentiert sich als großes Wohnzimmer der Burgstadt mit einem äußerst privaten Touch.
Fotogalerie
Als Filmemacher Klaus Stanjek, der Neffe von Willi Heckmann, vor rund 50 Zuschauern über die mehr als zehn Jahre währende Entstehung des Films berichtet, bettet sich sein Vorhaben ideal ein in den kommoden Charakter des Kinosaales: Er habe lange mit sich gerungen, die Geschichte seines Onkels und damit seiner Familie für die Leinwand aufzubereiten: "Das ist doch ein sehr privates Thema!" Doch irgendwann habe er realisiert, dass er als Filmemacher eine Mission erfüllen müsse - den Schleier fortzuzerren, der über dem Schicksal der im Dritten Reich verfolgten Homosexuellen im Allgemeinen und dem Schicksal seines Onkels im Besonderen lag.

Klaus Stanjek (77) musste erst seinen Lebenszenit überschreiten, um mit seinem Film "Klänge des Verschweigens" zu beginnen, in seiner Familie zu recherchieren, seine Verwandten zu befragen, die letzten Zeitzeugen aufzuspüren.
Stanjeks Großvater Adolf Heckmann besaß in Altena die gleichnamige Gaststätte Heckmann. Dessen Sohn Wilhelm, 1897 geboren, wuchs im Lokal auf, nahm am Ersten Weltkrieg teil und begann danach eine Ausbildung als Tenor und Pianist, startete eine durchaus erfolgversprechende Karriere als „Rheinischer Tenor“. Er trat in ganz Deutschland und der Schweiz auf, hatte aber zunächst noch immer sein Zentrum in Altena. Dort trat er in Lokalen und als Pianist im Kino auf.
1937 hatte er seine Wohnung in Passau genommen, trat von dort aus in Süddeutschland auf – und wurde in der Dreiflüssestadt Passau in „Schutzhaft“ genommen, weil ein Bezug zum Paragraphen 175 – „widernatürliche Unzucht unter Männern“ – hergestellt wurde.

Es begann – ohne Anklage, ohne Prozess – eine bis 1945 währende Lagerhaft in den Konzentrationslagern Dachau und Mauthausen, wo schwerste Arbeit im Steinbruch zu verrichten war, was im Regelfall Vernichtung durch Arbeit bedeutete. Wilhelm Heckmann gehörte jedoch auch zum Lagerorchester, was ihn wohl rettete. Bilder belegen das eindrucksvoll, bekannt ist unter anderem ein Aufzug des Lagerorchesters, das musizierend einem Häftling zur Exekution vorangeht. Solche Bilder sind fast die einzigen greifbaren Dokumente, als Klaus Stanjek seine Recherche begann.
Nur durch Zufall erfuhr Klaus Stanjek von den Lageraufenthalten seines Onkels
Der 1948 geborene Stanjek stieß nur durch Zufall, durch seltsame Andeutungen im Familienkreis inspiriert, auf die im Dunkeln liegende Geschichte seines geheimnisvollen, aber sehr geliebten Onkels, von dem es nur hieß, er sei einst „im Lager“ gewesen. Gespräche mit seinem Onkel endeten im Unklaren, verstummten im Schweigen, Beschweigen, Verschweigen. Der Onkel wollte nicht reden und verbat sich insbesondere einen Film zu seinen Lebzeiten. Heckmanns Tod 1995 stieß für Stanjek das Tor auf und er begann seine Ermittlungen.
Nachkriegs-Fotografien aus dem Familienbesitz zeigen einen Menschen mit gewinnendem Blick und weichen Gesichtszügen, erinnern an einen Menschen, der zeitlebens der Musik zugetan war, der nach dem Krieg in Gaststätten musizierte und Stimmung machte. Man sieht einen Mann, zuhause in Altena und in Wuppertal, der gesellig auftrat, in Würde alterte und mit 68 Jahren spät heiratete. Vom achtjährigen Aufenthalt in den Konzentrationslagern existieren nur wenige Bilder, die einen anderen Willi Heckmann zeigen: Leerer Blick, kahlgeschorener Kopf.

Interviews mit Familienangehörigen, in den Film eingebaut, lassen erschrecken – Stanjeks Mutter, Stanjeks Tante - sie müssen doch gewusst haben, wo sich Onkel Willi von 1937 bis 1945 befand. Auch Altenaer kommen zu Wort. Was man hört und sieht, ist unerträglich. In der Familie wird Wilhelm Heckmanns Schicksal über Jahrzehnte nicht nur totgeschwiegen, sondern umgefälscht. Man hört von der Tante mit versteinertem Gesicht, dass Vergessen doch etwas Nützliches sein könne. Man erlebt Klaus Stanjeks Mutter, wie sie von ihrer Mitgliedschaft im BDM (Bund Deutscher Mädel, Pendant zur männlichen Hitlerjugend) schwärmt und erfährt aus ihrem Munde, dass im Dritten Reich eigentlich alles sehr passabel gewesen sei, wären nur nicht die Konzentrationslager gewesen. Von denen habe man aber fast nichts gewusst.
Ein seltsames Weiterleben mit der deutschen Geschichte
Da ist die Wirtin des Altenaer Cafés Zur Burg, die sich genau an „Knödel“ Heckmann, den „Mann mit dem Akkordeon“ erinnert – und an „ihre Zeit“ im Dritten Reich: „Unsere schönsten Jahre“ sagt sie im Film und schwärmt in höchsten Tönen vom Führer. Hitler habe etwas positiv Erregendes gehabt.
Wieder ein Schwenk in Interviews in der Familie. Onkel Willi habe etwas „mit kleinen Jungs“ gehabt. Ein Kinderschänder also. Der homosexuelle (oder bisexuelle) Heckmann, der weiche Mann, wird umgedeutet zum gefährlichen Triebtäter. Seine Familie verrät ihn gewissermaßen, macht ihn verächtlich, kriminalisiert ihn. Seine künstlerische Arbeit wird herabgewürdigt: Der Onkel habe in Nachtclubs musiziert – Geklimper in anrüchigem Rotlicht wird unterstellt.
Rehabilitiert wird Wilhelm Heckmann nie. Eine Entschädigung als NS-Verfolgter und KZ-Insasse lehnt der Staat 1960 ab – der Paragraph 175 ist da noch unverändert in Kraft; der abgelehnte Antrag auf Entschädigung formuliert damit 15 Jahre (!!!) nach dem Untergang des Tausendjährigen Reiches ein ungeschriebenes, ungesagtes „Zu Recht im KZ eingeknastet“.
In der Filmvorführung im Apollo-Kino in Altena weiß man am Donnerstag bald nicht mehr, wofür man mehr Scham empfinden soll – für deutsche Gräueltaten im Dritten Reich, für die fortwährende Nachkriegs-Diskriminierung oder die innerfamiliäre Niedertracht, für Verschweigen und Verleumden. Atemlos verfolgt man die Rechercheergebnisse von Klaus Stanjek auf der Leinwand, die – sieht man es wertneutral – das Schicksal des Onkels nicht mehr vollständig aufklären können. Stanjeks Ermittlungen, so gründlich sie auch waren, die ihn in zahlreiche Archive und an Originalschauplätze geführt haben, kommen zu spät. Unterlagen sind nicht mehr vorhanden, Augenzeugen verstorben. Es bleibt – Beklemmung, Betroffenheit, Traurigkeit, Sprachlosigkeit.
Altena diskutiert im Kino, wie man mit dem Totschweigen umgehen soll
Als der Film endet, dauert es einen Moment, bis der Applaus einsetzt. Dann beginnt Altena zu diskutieren. Moderiert von dem ehemaligen Kreisarchivar Ulrich Bieroth geht es um die langlaufenden Recherchen und die Produktion des Filmes, um Loyalitätsgefühle gegenüber der eigenen Familie und um die Tatsache, dass die Männer mit dem „rosa Winkel“ auch nach 1945 verächtlich gemacht wurden, sie zum Versteckspiel gezwungen waren, dass sie selbst lange schwiegen. Aber auch das hört man: Das Beschweigen, gar Totschweigen in den Familien war typisch. Das in den Jahren des Dritten Reiches Geschehene war hinter vielen Türen ein Nicht-Thema.
Dann melden sich im Kino zwei Altenaer, die sich an den Gesang des Wilhelm Heckmann erinnern. Der eine lobt den Sänger in den höchsten Tönen, ist dankbar, Heckmann erlebt zu haben. Der andere sagt, in der Nachbetrachtung müsse man das (bisher?) nicht wissen, dass Heckmann im KZ gewesen sei. – Diese Aussage: Ist sie nur mindestens missverständlich oder die Legitimation neuen Totschweigens? Die im Film versteinerten Gesichter der Familie, die Sprachlosigkeit müsse man jedenfalls akzeptieren ohne zu richten, möchte der Altenaer mitteilen.
Eine Dame aus dem Publikum beklagt mangelnde öffentliche Erinnerungskultur in Altena, wünscht sich einen Stolperstein, wo früher das Gasthaus Heckmann stand. Klaus Stanjek vermeldet daraufhin, dass im kommenden Februar in Passau ein Stolperstein für seinen „Onkel Willi“ eingesetzt werde – dort, wo der Musiker wohnte und verhaftet wurde.
Am 27. Januar 2026 werde es zudem im NRW-Landtag im Rahmen des Holocaust-Gedenktages eine Aufführung von Filmszenen aus den „Klängen des Verschweigens“ geben.
Kann uns das alles wieder blühen?
Dann aber kommt sie aus dem Publikum, diese unausweichliche Frage an Klaus Stanjek: „Haben Sie Furcht, dass es wieder passiert?“
Pause, Stille. Stanjek überlegt. Dann antwortet er langsam: „Das wird schwierig. Ich hoffe auf Bildung. Dafür gibt es uns Filmemacher.“ Wieder eine Pause – und dann: „Nicht darüber zu reden hilft nicht.“
Das große Wohnzimmer, das sich Apollo-Kino nennt, entlässt stumm gewordene Zuschauer, Zuhörer, Diskutanten in das regennasse, düstere Altena. Es gibt nichts, das man an diesem Abend beschönigen möchte.