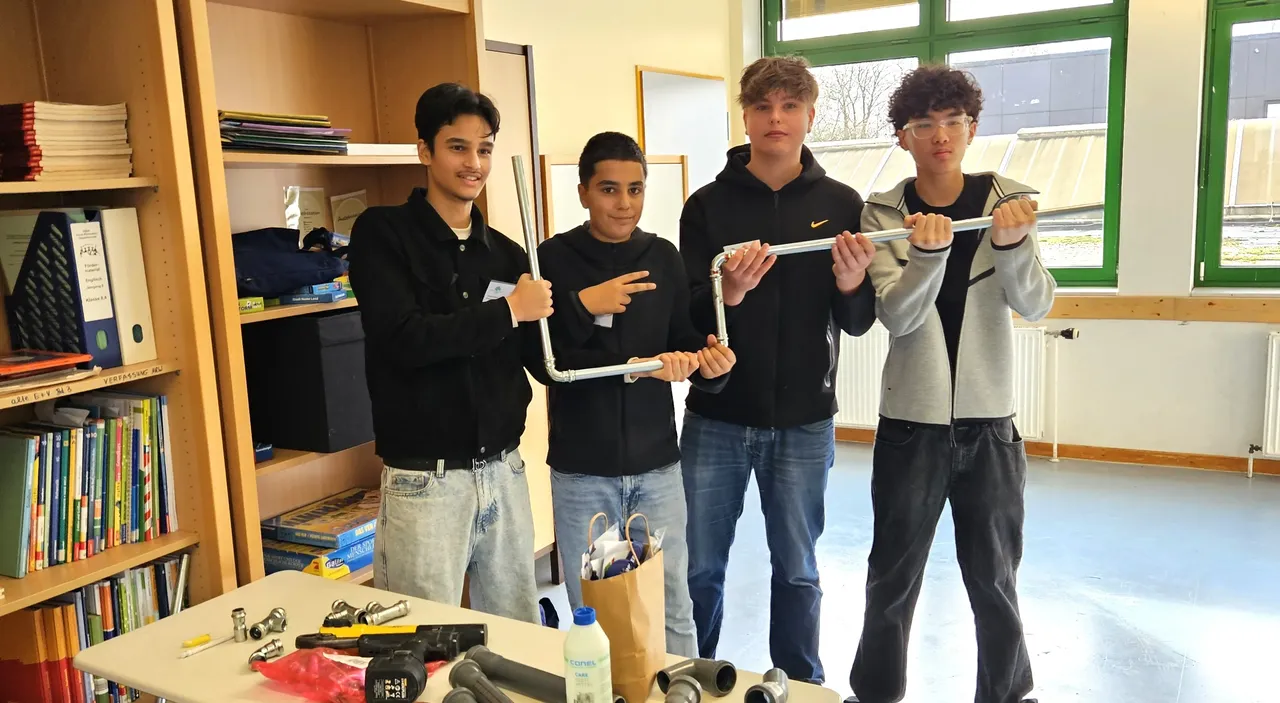Kräftige Schläge mit einem Schonhammer mit Gummikopf hallen durch die Bahnhofstraße. Vor dem Haus Nr. 48 verlegt Frank-Matthias Mann vier mit Messing überzogene Pflastersteine. Fast übertönt er den Verkehrslärm am Freitagvormittag. Die Steine haben eine besondere Bedeutung. Sie erinnern an die jüdische Familie Slager, die von den Nazis verfolgt, verhaftet und ermordet wurden.
Pflasterer Frank-Matthias Mann ist Mitarbeiter der Stiftung „Spuren“, gegründet von Gunter Demnig, der als „Künstler der Stolpersteine“ bekannt geworden ist. Mit den quadratischen Stolpersteinen erinnert er an getötete Fahnenflüchtlinge, Juden, Kranke, Homosexuelle und Oppositionelle während der Nazi-Herrschaft.
In Lüdenscheid wurden bei einer von dem Verein Ge-Denk-Zellen „Altes Rathaus“ koordinierten Aktion am Freitag, 14. November, insgesamt 17 Stolpersteine an sieben Standorten im Stadtgebiet verlegt – eine Menge Arbeit für Frank-Matthias Mann. An einigen Stellen musste er mit seiner Flex ausgehobenes Pflaster anpassen, damit es sich mit den Stolpersteinen wieder nahtlos auf dem Gehweg einfügte.
Die Patenschaft für einen der Stolpersteine vor dem Haus Bahnhofstraße 48 hat das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (GKB) übernommen. Er erinnert an David Slager und Regina „Dina“ Slager. Die jüdische Familie betrieb in dem Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße einen Obst- und Gemüsehandel. Inhaber David Slager musste das Geschäft 1936 schließen, weil die Kundschaft ausblieb.
GKB-Schüler Tom Kufeld erinnerte an zwei Menschen, die einst mitten in Lüdenscheid lebten, arbeiteten und Teil der Stadtgesellschaft waren – bis ihnen durch die nationalsozialistische Verfolgung alles genommen wurde.

„Ihre Namen stehen nun wieder sichtbar dort, wo ihr Leben einst zu Hause war“, sagte er. Er verdeutlichte, wie schnell demokratische Werte erodieren können und wie wichtig es ist, wachsam zu bleiben – gegen Antisemitismus, Hass und jede Form von Ausgrenzung. Hella Goldbach von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit sprach zum Schluss der Gedenkfeier das „Kaddisch“, das wohl bekannteste Trauer-Gebet Menschen jüdischen Glaubens.
Benjamin Slager starb 1941 in Groningen, Elisabeth Slager kam im KZ Westerbork ums Leben. Regina Slager verlor ihr Leben im KZ Sobibor, David Slager starb im KZ Auschwitz.
Weitere Stolpersteine wurden an der Buckesfelder Straße/Ecke Alte Wache, Bahnhofstraße 32, Thünenstraße 6, Hochstraße 23 (Geschwister-Scholl-Gymnasium) und Schillerstraße 6 verlegt.
Am Geschwister-Scholl-Gymnasium erklang zur Gitarrenbegleitung in Erinnerung an Marianne Dickehut der Clapton-Song „Tears in Heaven“. Marianne Dickehut war Schülerin des Mädchen-Lyceums am Staberg. 1939 wurde sie, vermutlich wegen einer Hasenscharte, operativ behandelt. Wie der Ge-Denk-Zellen-Verein erforschte, kam es dabei vermutlich zu Komplikationen. Die junge Frau litt danach unter Angstzuständen und Selbstmordgedanken. Nach verschiedenen Behandlungen wurde sie auf Beschluss des Erbgesundheitsgerichtes Arnsberg zur Zwangssterilisation nach Paderborn eingewiesen. Später wurde sie in die Tötungsanstalt nach Hadamar verlegt. Dort starb sie am 15. September 1943. In ihrer Todesurkunde wurde als offizielle Todesursache Grippe vermerkt.
Michael Rose, einer der Schüler, die sich engagiert für Erinnerungskultur einsetzen, sagte bei der Gedenkstunde: „Marianne konnte sich nicht wehren. Wir können dafür sorgen, dass sie nicht vergessen wird. Erinnerung bedeutet Wachsamkeit.“
An der Aktion waren beteiligt: AWO-Ortsverein, Jusos Lüdenscheid, Friedensgruppe Lüdenscheid, Gertrud-Bäumer-Berufskolleg, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Adolf-Reichwein-Gesamtschule, Zeppelin-Gymnasium, Geschwister-Scholl-Gymnasium, CSD Lüdenscheid, Familie Feldmann, Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebe Lüdenscheid (STL). Koordiniert wurde die Aktion vom Verein Ge-Denk-Zellen „Altes Rathaus".