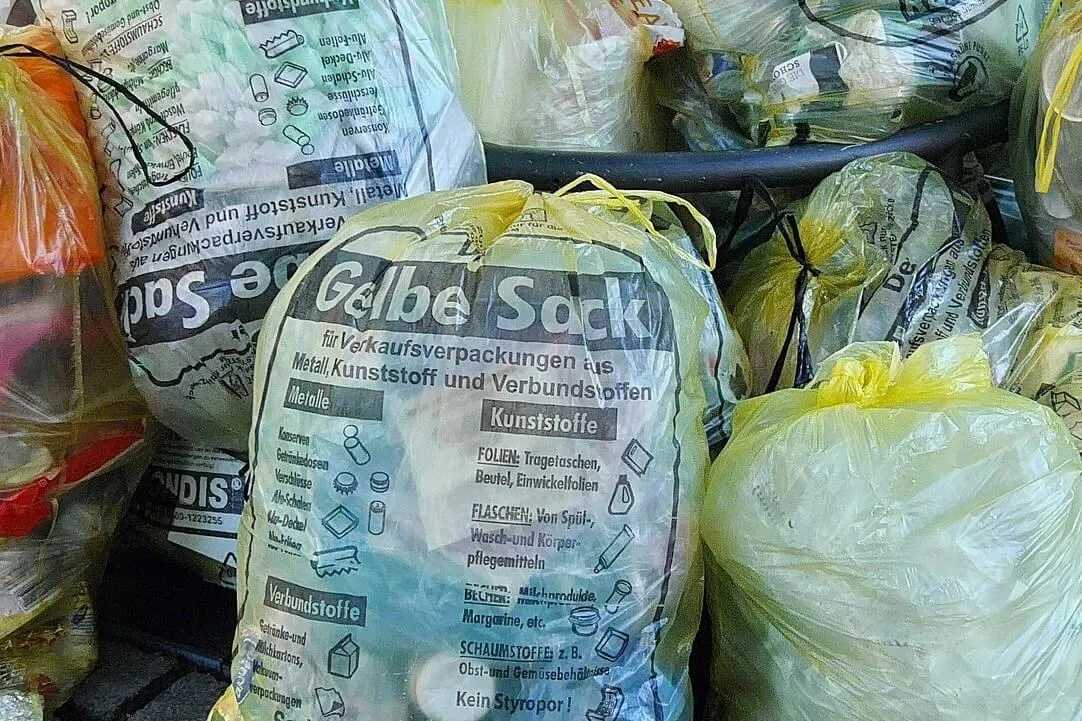Das Ausbildungsjahr 2024/2025 ist gelaufen, fast jedenfalls. Ausbildungsjahr – das bedeutet Bewerbung in 2024, Auswahl und Einstellung zwischen Herbst 2024 und Frühjahr 2025, Antritt der Lehrstelle im Sommer 2025. Um Bilanz zu ziehen und restliche Ausbildungsstellen zu benennen, trat bei Elektro Busch Jäger eine ansehnliche Zahl von Funktionsträgern aus Industrie, Handwerk, Agentur für Arbeit und Gewerkschaft vor die Presse.
Überregionale Nachrichten
Die märkische Wirtschaft ist in der Krise – das zeigen wöchentlich eintreffende Meldungen über Arbeitsplatzabbau und Insolvenzen. Die problematische Wirtschaftslage findet ihre Entsprechung auf dem Ausbildungsmarkt, legten Stefan Steinkühler (Agentur für Arbeit Iserlohn) und Carmen Drobela (Jobcenter) Zahlen vor. Es gab mehr Bewerber um Ausbildungsstellen, aber weniger Lehrstellen. Innerhalb von nur zwei Jahren wurde ein Fünftel weniger Ausbildungsstellen angeboten. Und dennoch: 215 Lehrstellen blieben unbesetzt. Dem stehen 240 unversorgte Bewerber um einen Ausbildungsplatz gegenüber.
Es könnte also passen, wenigstens rein mengenmäßig – tut es aber nicht! Christian Lepping vom Arbeitgeberverband berichtete von erheblichen Ausbildungshemmnissen bei vielen Jugendlichen. Das beginne da, dass „man“ sich immer später um eine Lehrstelle bewerbe und das Recruiting erst kurz vor dem Lehrbeginn ende; das setze sich fort in ungenügenden Leistungen in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, in mangelndem Textverständnis und fehlender Allgemeinbildung.
Handwerkskammer-Vertreter Jens Rodermund bestätigte das – und sprach von einem erheblichen Nachqualifizierungsbedarf, der von den Betrieben an den jungen Leuten zu leisten sei. Kehrseite dieser Medaille sind Abbrecherquoten, die erst auf den zweiten Blick verständlich werden. Er bekräftigte, dass nur umfassend technisch ausgebildete Mitarbeiter die Grundlagen für eine erfolgreiche betriebliche und persönliche Zukunft bildeten. Angesichts schwächerer Abgangsschüler überlegte er, ob kürzere, vereinfachte Ausbildungen (die einfachere Tätigkeiten ermöglichen) sinnvoll seien. Gegebenenfalls könne man solche Mitarbeiter später nach- und weiterqualifizieren.
Stefan Marx als Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes warb für Realismus, dafür, mit den jungen Leuten zu arbeiten, die man vor sich habe – Menschen mit all‘ ihren persönlichen Fähigkeiten und Schwächen, mit Familienproblemen und dem Rucksack aus Schulausfall und Corona-Lockdown. Er rief die Firmen auf, weiter auszubilden, damit nicht in fünf Jahren der Nachwuchs im Beruf fehle. Er forderte eine „ganz starke industriepolitische Ausrichtung der Landespolitik“ ein.
Thomas Haensel von der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zeichnete das Bild einer „Bugwelle, die uns dadurchgeht“. Gemeint sind Jugendliche, die eine falsche Selbsteinschätzung haben und irreale Vorstellungen von der Ausbildung entwickelten. Es sei ein gesellschaftliches Problem, das nicht verstanden werde, was Ausbildung, Arbeit, Erwerbsleben sei. Die Generation, die im Lehrstoff zwei Jahre hinterher sei, frage nicht nach einer Ausbildungsstelle, sondern danach, was ihr geboten werde und formuliere so ein „Trag‘ mich noch ein Stück“. Denen müsse man ein „Werdet wach, bewegt Euch“ zurufen.
Auch Stefan Marx (DGB) formulierte in der Pressekonferenz eine „Riesensorge vor der Bugwelle“, die – werde sie nicht gebrochen - die Betroffenen direkt in die Transfergesellschaft (d.h. Bürgergeld) lenke und zu weiterem Fachkräftemangel führe, zum Abwandern der Arbeitsplätze ins Ausland. Und: „Die Bugwelle ist demokratiegefährdend. Das können wir uns wirtschaftlich, politisch und sozial nicht leisten.“
Die große Chance, die Welle einzufangen, gebe es übrigens im nächsten Jahr: 2026 fehlt wegen des Wechsels von G8 auf G9 ein kompletter Abiturjahrgang, was zu einem deutlichen Überangebot an Lehrstellen führen wird. Wer jetzt also keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, findet für 2026 optimale Startvoraussetzungen vor.