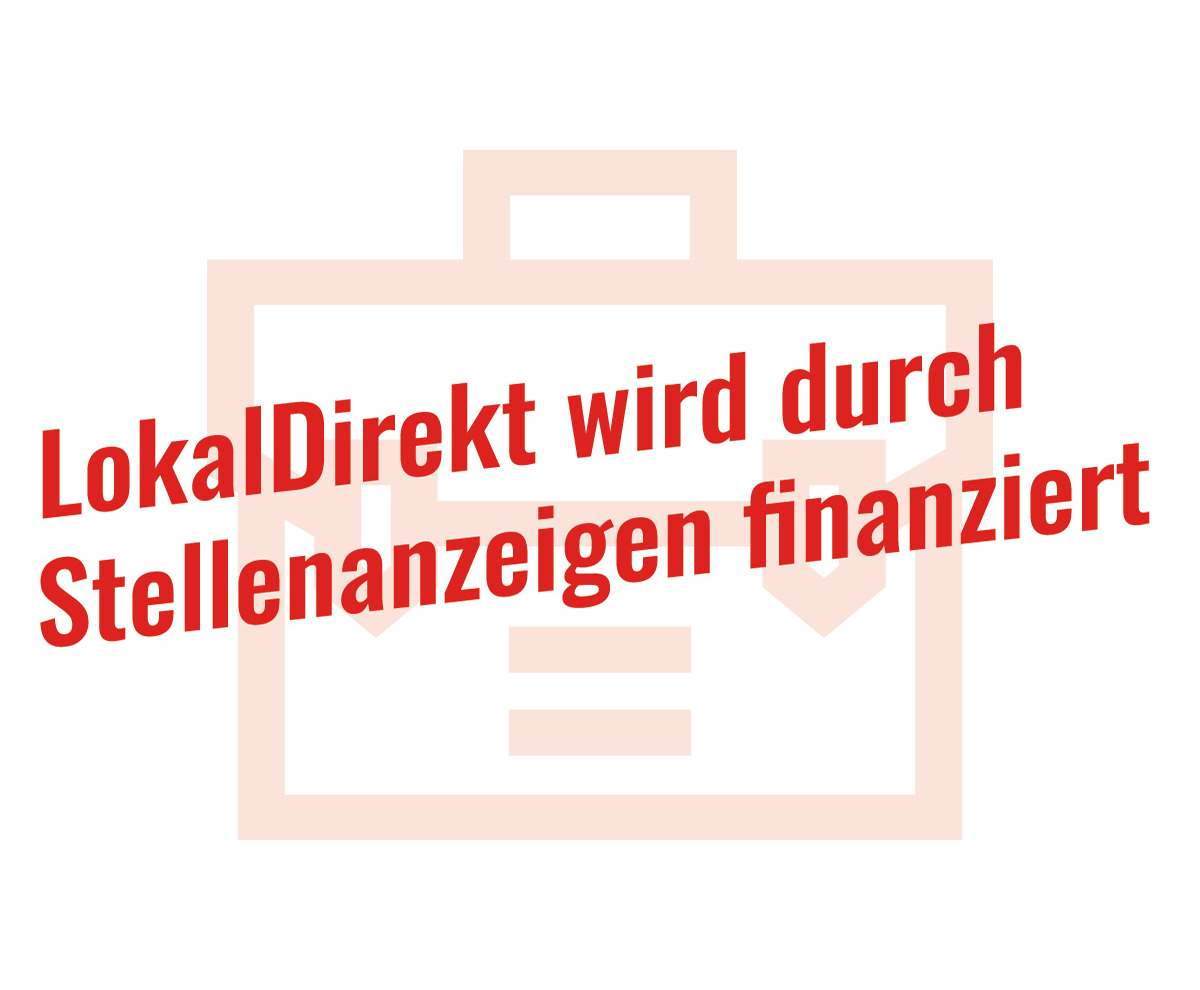Feuersbrünste gehören zu den schlimmsten Heimsuchungen in Städten seit ihrer Entstehung und zur DNA der Erinnerungskultur der Stadtgeschichte. Am späten Nachmittag des 12. Aprils 1725, es war ein Donnerstag, brach in Plettenberg ein Feuer aus, das sich in wenigen Minuten über das ganze Stadtgebiet ausweitete. Die Folgen der Katastrophe: 94 Prozent der Stadt waren vernichtet, mindestens vier Menschen verbrannten in den Flammen, über 30 wurden verletzt. Etwa 700 Menschen waren obdachlos. Mit ihren Häusern verloren sie auch ihre Heimarbeitsplätze.
Am Samstag, 12. April, um 19 Uhr in der Christuskirche hält der 2. Vorsitzende des Heimatkreises, Volker Hauer, einen Vortrag, um an diese Katastrophe zu erinnern. Er stellt andere Städte mit gleichem Schicksal durch die Jahrhunderte vor und berichtet, welche Lehren daraus gezogen wurden. „Die Brandbekämpfung wurde verbessert, die Feuerschutzversicherung eingeführt, Architektur und Städtebau wurden angepasst“, nennt Volker Hauer Beispiele.
Nach dem etwa einstündigen Vortrag, bei dem auch Pläne und Bilder der alten Stadt Plettenberg gezeigt werden, wird auf dem Kirchplatz eine szenische Darstellung an den verheerenden Stadtbrand von 1725 erinnern. Der Turm der Christuskirche wird illuminiert; es werden Klangeffekte eingesetzt; Puppen in Kostümen aus dem Fundus der Plettenberger 600-Jahr-Feier bevölkern den Kirchplatz.
„Es ist in erster Linie ein Gedenktag“, betonen Günter Heerich, 1. Vorsitzender des Heimatkreises, und Volker Hauer. Daher solle der Eventcharakter nicht übertrieben werden.