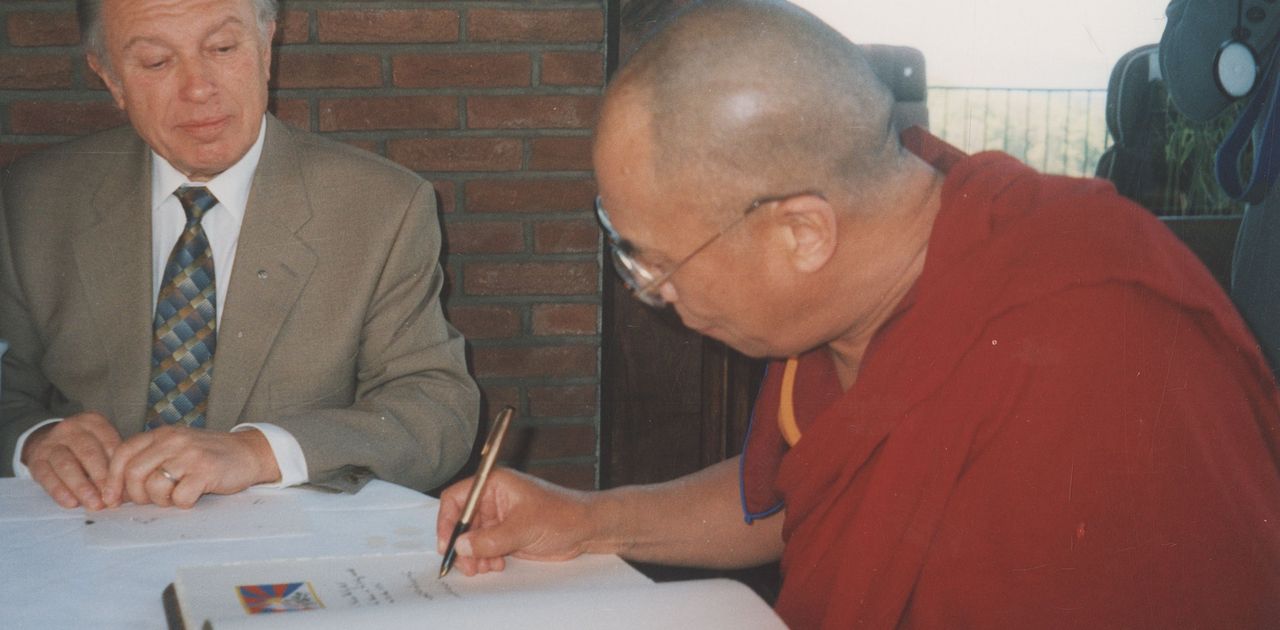„Im letzten Jahr hatten wir Scotch. Dieses Mal gibt es alles außer Scotch“, erklärte Daniel Schmidts seinen Gästen zur Begrüßung. Der Ursprung des Whiskys liege in Irland oder Schottland. „Darum streiten die sich heute noch“, berichtete der Experte. Los ging es aber mit einem ganz anderen – nämlich einem Whisky aus den USA. „Auswanderer brachten den Whisky mit nach Amerika“, erklärte Daniel Schmidts. Es gab jedoch ein Problem: Whisky bestehe in Schottland immer aus Gerste. Die wachse jedoch in Kentucky nicht gut. Also orientierten sich die Hersteller auf eine Mais-Grundlage. „Daraus ist Bourbon entstanden. So darf nur amerikanischer Whisky heißen“, betont der Referent. Besonders beliebt sei der amerikanische Premium Whisky Kentucky Straight Bourbon. „Der muss in neuen Weißeichenfässern mindestens zwei Jahre lagern. Nur wenn er älter als vier Jahre ist, darf die Altersangabe auf dem Etikett fehlen“, erklärte Daniel Schmidts.
Mitgebracht hatte der Experte einen Wild Turkey. Mit 50,5 Prozent Alkohol zähle der zu den eher stärkeren Sorten. „Ein hoher Alkoholgehalt ist für die Amerikaner typisch. Und dennoch soll der amerikanische Whisky mild und weich sein. Dieses Paradoxon will jeder Hersteller dort perfektionieren“, erläuterte Schmidts.
Er erklärte auch, wie ein solcher Bourbon am besten gekostet wird. Dabei sei vor allem das Glas wichtig: „Ein typisches Glas – wie oft in Filmen – mit einer großen Öffnung, ist eher ungeeignet. Besser ist ein Glas mit einer schmaleren Öffnung.“ Wenn das Glas zu weit offen sei, ginge zu viel Geruch verloren – und gerade der sei entscheidend. Über die Nase könnten die Verkoster einen Whisky viel besser kennenlernen als über den Geschmack. Außerdem sollte – ebenfalls anders als in Filmen – kein Eis in den Whisky: „Eis verdünnt unkontrolliert, außerdem betäubt es die Zunge und damit die Geschmacksnerven.“ Gegen eine gezielte Verdünnung sei hingegen nichts einzuwenden. Sie sei oft sogar gut, da sie noch einmal andere Komponenten des Whiskys öffne.

„Wer Drinks mit einem so starken Alkoholgehalt nicht gewöhnt ist, sollte unbedingt vorher einen Schluck Wasser in den Mund nehmen, dann einen genauso großen Schluck Whisky nehmen und so den Bourbon direkt im Mund verdünnen“, erklärte Daniel Schmidts. Alternativ könne auch eine Pipette genutzt werden. Bevor es aber ans Kosten ging, wurde zunächst einmal die Farbe des Whiskys analysiert. Dafür hatte der Referent eine Farbpalette ausgelegt, mit der die Tester die Farbe zuordnen konnten.
Im Fall des Wild Turkey lag das Urteil zwischen Strohgelb, Honig und einem Tick Mahagoni. Grundsätzlich sei der amerikanische Bourbon eher dunkel. Das liege an der Reifung in den zuvor ungenutzten Weißeichenfässern. „Wenn das Fass ganz neu ist, gibt das Holz auch mehr Farbe ab“, erklärte Daniel Schmidts. Im Fall der amerikanischen Sorten sei die Farbe somit durchaus ein Qualitätsmerkmal. Bei den Schotten dürfe man sich von der Farbe nicht beirren lassen: „Die dürfen ihren Whisky auch färben.“

Nach der optischen Probe, folgte die Geruchsprobe. Die Gäste fanden eine Mischung aus Vanille, Karamell, Honig und Klebstoff. „Ja, das ist durchaus richtig. Denn Mais ist Stärke und nichts anderes als Klebe. Grundsätzlich kann man sagen, je günstiger ein Bourbon ist, desto mehr riecht er nach Klebe.“ Der Geruch von Vanille stammt übrigens ebenfalls von den Weißeichefässern. Die geben bei der Lagerung einen Vanillinstoff ab.