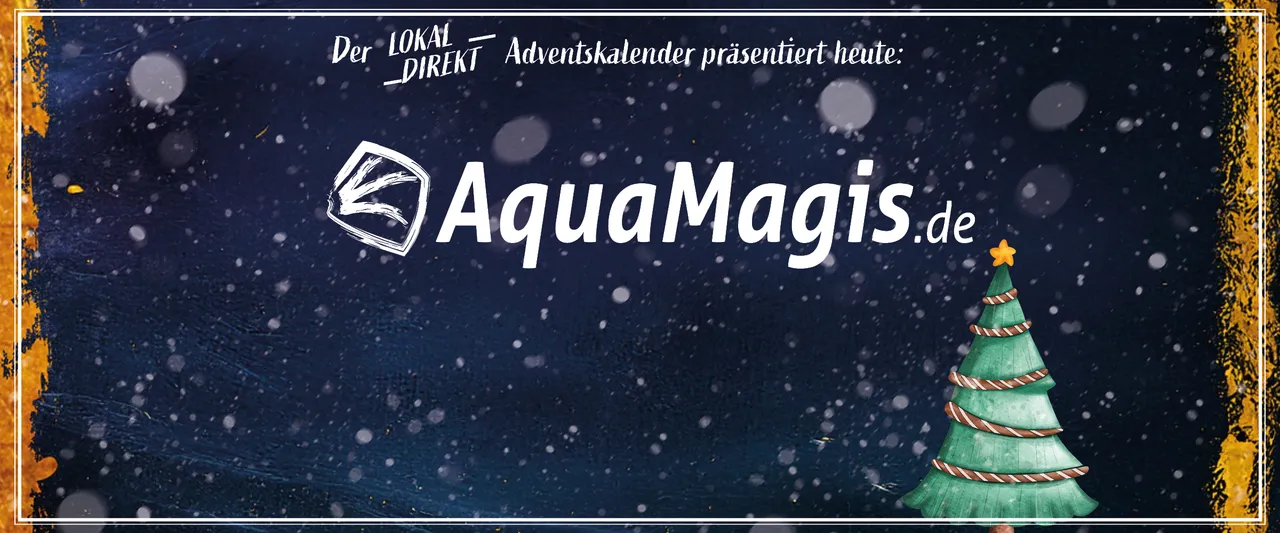Maxim Davidowitsch Sakom stammte ursprünglich aus Litauen. Dort wurde er am 17.1.1880 in Poniewesch, Governement Kowno, geboren. Seine Eltern waren der Rechtsanwalt David Salomonowitsch und seine Frau Frumma Jankelowna geb. Mytnikowitsch. Maxim Sakom wuchs also in einem bürgerlichen Elternhaus auf. 1899 machte er sein Abitur. Im darauffolgenden Jahr zog es Maxim Sakom nach Darmstadt. Dort immatrikulierte er sich an der Technischen Universität und studierte Elektrotechnik.
Der im Jahr 1883 an der TU Darmstadt eingerichtete Studiengang für Elektrotechnik stieß auf großes Interesse, was die stetig steigende Studentenzahl zeigte. Der Studiengang zog vor allem auch viele ausländische Studenten, im Wesentlichen aus Osteuropa, an. So waren 1906 knapp 75 Prozent aller Studenten der Elektrotechnik ausländische Studenten, zu denen auch Maxim Sakom gehörte. Im Mai 1908 bestand Maxim Sakom seine Diplomprüfung. Anfang 1910 verließ er Darmstadt in Richtung Plettenberg. Er arbeitete nun als Diplom-Ingenieur beim Elektrizitätswerk Mark und wohnte zunächst in Eiringhausen.
Während seiner Darmstädter Zeit hatte Maxim Sakom seine Frau Gertrude geb. Fuchs kennengelernt. Sie war die Tochter des Metzgers Marcus Fuchs und seiner Ehefrau Rosa. Am 2.1.1912 heiratete das Paar in Darmstadt und lebte fortan gemeinsam in Eiringhausen. Im Oktober 1913 wurde Tochter Gertrud geboren und die Familie zog von Eiringhausen in die Stadt. Dort bezog sie eine Wohnung in der Grünestraße.
Über das alltägliche Leben der Sakoms wissen wir recht wenig. Eine Freundin der Tochter berichtete, dass die Sakoms sehr sympathische und gebildete Leute gewesen seien. Maxim Sakom habe sehr gut Klavier gespielt und seine Frau habe viele Arien aus Operetten und Opern gekannt und gesungen, da sie als junges Mädchen Gelegenheit gehabt hatte, in Darmstadt das Theater zu besuchen. Tochter Gertrud besuchte zunächst ab 1920 die evangelische Volksschule und wechselte im Jahr 1924 auf die Töchterschule in Plettenberg.
Insgesamt dürften die Sakoms in der Weimarer Zeit ein bürgerliches und auskömmliches Leben geführt haben. Dies änderte sich jedoch mit dem Jahr 1933. Hitlers Machtübernahme bedeutete auch für die Sakoms einen radikalen Einschnitt in ihr bisheriges Leben und die antijüdischen Gesetze und Maßnahmen der Jahre nach 1933 dürften bei Sakoms wie bei den anderen in Plettenberg lebenden jüdischen Bürgerinnen und Bürgern ihre deutlichen Wirkungen und Spuren hinterlassen haben.
Die Pogromnacht im November 1938 machte eins noch einmal ganz deutlich: Ein normales Leben war nicht mehr möglich. Maxim Sakom wurde mit anderen Plettenberger Juden verhaftet. Er wurde krankheitsbedingt, er war sehr herzkrank, jedoch wieder aus der Haft entlassen, allerdings hatte man ihm eindringlich klargemacht, dass für ihn und seine Familie in Deutschland kein Platz mehr sei und sie ihre Auswanderung systematisch zu betreiben hätten.

Sakoms beantragten ihre Auswanderung. Gleichzeitig erlaubte ihnen die örtliche Polizeibehörde im Juni 1939 nicht, noch länger in Plettenberg zu bleiben. Das Ehepaar Sakom verließ gemeinsam mit seiner Tochter am 25.6.1939 die Stadt und zog nach Aachen. Dort wohnten sie nun in einem Haus, in dem auch die Plettenberger Jüdin Dina Sternberg lebte; sie war ein paar Monate zuvor nach Aachen gezogen.
Mitte August 1939 verließ Sakoms Tochter Aachen und emigrierte nach England. Danach haben sich Eltern und Tochter nie wiedergesehen. Maxim Sakom verstarb am 18.2.1940 im Forster Krankenhaus in Aachen. Die Jahre des Naziterrors dürften dem sehr Herzkranken arg zugesetzt haben. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof in Aachen beerdigt. Seine Ehefrau Gertrude lebte noch bis Ende März 1942 in Aachen. Dann wurde sie gemeinsam mit Dina Sternberg mit dem Zug DA 17 von Aachen aus über Düsseldorf/Koblenz nach Izbica deportiert. In Izbica wurden sie nach der Ankunft als „Transport III“ registriert. Sie wurde im Vernichtungslager Majdanjek ermordet.

Die Tochter Gertrud Sakom hat den Holocaust überlebt. Sie lebte nach ihrer Emigration einige Jahre in England, wo sie als Hausmädchen bei einem Holzhändler arbeitete. In England lernte sie auch ihren Mann Wolfgang Gumpert kennen. Die beiden heirateten und entschlossen sich, nach Amerika auszuwandern. Dort lebende Verwandte von Gertruds Mutter wollten ihnen eine Starthilfe geben. Viele Jahre lebte das Ehepaar in New Jersey, verlegte dann seinen Wohnsitz nach St. Petersburg/Florida. Dort ist Gertrud Sakom im Juni 1993 verstorben.
Ähnlich wie bei der Familie Bachrach, deren Tochter Marianne 1939 in die USA emigrierte, so hat auch bei den Sakoms die junge Generation den Holocaust überlebt. Für die jeweiligen Eltern war es vermutlich ein kleiner Trost zu wissen, dass die Kinder die familiären Lebenszusammenhänge mit in die neue Welt haben nehmen können.
In Plettenberg findet die Gedenkstunde zum Tag der Opfer des Nationalsozialismus am Montag, 27. Januar, statt. Sie beginnt um 16 Uhr auf dem jüdischen Friedhof an der Freiligrathstraße. Zu ihr sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.