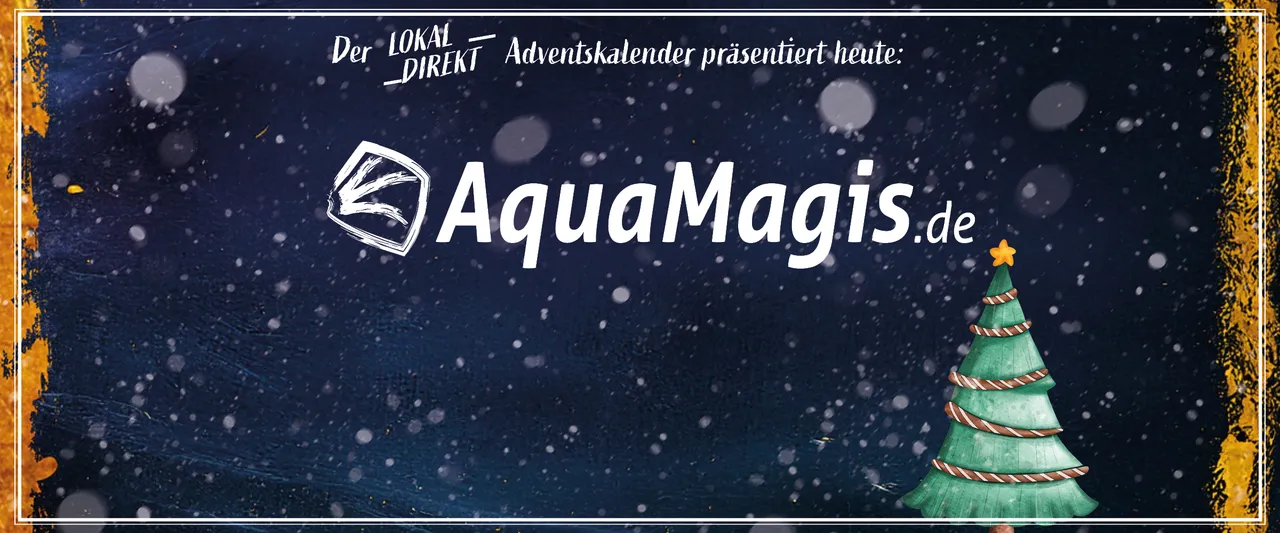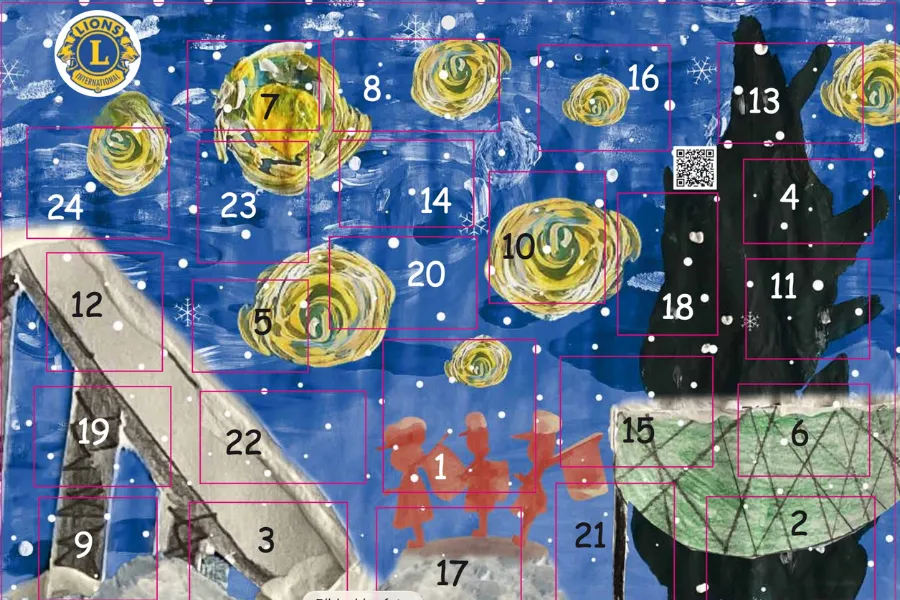Seit 21. März dieses Jahres befasst sich ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit dem Desaster um die Talbrücke Rahmede (PUA III). Am Mittwoch (9. August) hat der Ausschuss im Lüdenscheider Rathaus getagt und dabei zehn Zeugen vernommen, wie es im PUA-Jargon heißt. Dabei ging es allerdings weniger um Versäumnisse der Landesregierungen seit 30. Juni 2017 als mehr um die schwierige Lage Lüdenscheids und der gesamten Region, die seit Dezember 2021 vom Brückendesaster betroffen ist.
Vor der Sitzung hatten sich die Ausschussmitglieder ein Bild von der Baustelle verschafft. „Von der Abrisskante aus“, erläuterte Ausschussvorsitzender Stefan Engstfeld (Grüne) im Gespräch mit LokalDirekt. Den Baustellenbereich konnte die Delegation aus Sicherheitsgründen nicht betreten. Auf dem Gelände, das nach der Brückensprengung am 7. Mai jetzt für den Neubau vorbereitet wird, habe reger Baustellenverkehr geherrscht. So habe der Ausschuss einen guten Einblick in den aktuellen Stand der Arbeiten und insbesondere auch von der schwierigen topographischen Lage erhalten.
Mit welchen Schwierigkeiten die Menschen in Lüdenscheid und der Region, Handel, Dienstleistungsgewerbe und Industrie zu kämpfen haben, schilderten Landrat Marco Voge und die Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (Lüdenscheid), Jan Nesselrath (Meinerzhagen) und Olaf Stelse (Kierspe). Zur Sprache kamen unter anderem die mindestens 650 Millionen Euro volkswirtschaftlicher Schaden pro Jahr, übermäßige Belastung des Straßennetzes und als Folge Gesundheitsschäden bei Menschen, die an den überlasteten Verkehrsadern wohnen.

Dazu hätten die Unternehmen im heimischen Raum zunehmend Probleme, ihre Mitarbeiter zu halten und neue zu gewinnen. „Das Brückendesaster hat wie ein Brennglas gewirkt und bestehende Probleme nochmals verstärkt“, sagte Sebastian Wagemeyer.
„Nach dem Kollaps kommt der Tod“, drückte es Jan Nesselrath drastisch aus. Die Region werde nicht abgehängt. Sie sei bereits abgehängt. Erste Unternehmen hätten ihren Aktivitäten bereits an Standorte „jenseits der Brücke“ verlagert. Kritisiert wurde die mangelhafte Kommunikation mit übergeordneten Behörden. „Wir fühlten uns nicht ernst genommen“, sagten Jan Nesselrath und Olaf Stelse.

In einer zweiten Runde ging es weiter ins Detail. Aus ihrer speziellen Sicht schilderten Dr. Frank Hoffmeister (Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Lüdenscheid) und Christian Lepping (Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Lüdenscheid) die Folgen des Brückendesasters. „Seit eineinhalb Jahren erhalten unsere Unternehmen Kündigungen von Menschen, die aus dem südlichen Ruhrgebiet und benachbarten Kreisen in den Raum Lüdenscheid einpendeln“, berichtete Christian Lepping. Aus dem Fachkräftemangel werde langsam, aber sicher ein Arbeitskräftemangel.
Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Geschäftsführung der Märkischen Gesundheitsholding, beklagte das Abwandern von medizinischem und pflegerischen Fachpersonal. Inzwischen gebe das Klinikum Lüdenscheid viel Geld für Honorarkräfte aus, deren Einsatz nur zu 50 Prozent von den Krankenkassen erstattet werde.
Fabian Ferber, Geschäftsführer der IG Metall im Märkischen Kreis, kritisierte die mangelhafte Baustellenplanung von Straßen.NRW. Sie habe die Verkehrsprobleme an der ein oder anderen Stelle zusätzlich verschärft. Er schilderte auch die Sorgen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Für die Betriebe werde es zunehmend schwierig. Seine Prognose: „Mir fehlt der Glaube, dass die abgewanderten Arbeitskräfte jemals wieder zurückkommen.“
Stefan Hesse, Vorstand des Caritasverbandes Lüdenscheid-Altena, ging insbesondere auf die Schwierigkeiten ein, mit denen ambulante Pflegedienste in der Region zu kämpfen haben. „Schon am Tag nach der Sperrung war die Katastrophe da“, sagte er. Zwölf Pflegedienste und rund 800 Pflegebedürftige hätten zunächst nicht gewusst, wie es weitergehen solle. Inzwischen hätten sich die Abläufe eingespielt. Allerdings befänden sich alle Pflegediensteaufgrund längerer Fahrzeiten und des insgesamt erhöhten Aufwands in einer finanziellen Notlage. Er bezifferte den Mehraufwand pro Pflegebedürften auf rund 1200 Euro. „Das können wir natürlich nicht auf die Betroffenen umlegen.“
Dr. Ralf Geruschkat, Hauptgeschäftsführer der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer, forderte einen Nachteilsausgleich für die Wirtschaft, die unverschuldete in diese Lage geraten sei. „Wir verpassen Zukunftschancen, weil sich jetzt andere Wirtschaftsstandorte schneller weiterentwickeln“, sagte er.
Christopher Rehnert, Leiter der Lüdenscheider Feuerwache, schilderte, dass Feuerwehr und Rettungsdienst zunächst unter schwersten Bedingungen gearbeitet hätten. „Die Gerätehäuser waren nicht schnell genug zu erreichen. Einsatzfahrzeuge kamen kaum durch den Verkehr.“ Insgesamt hätten sich die Einsatzzeiten spürbar verlängert. Zudem habe die Feuerwehr erhöhten Aufwand durch den Bau einer zusätzlichen Feuerwache am Römerweg gehabt. Sorgen macht er sich um mittelbare Folgen. „Die Situation führt zu Demotivation der ehrenamtlichen Feuerwehrleute.“
PUA-Vorsitzender Stefan Engstfeld dankte allen für ihre Ausführungen. „Sie haben uns Einblicke geliefert, die für unsere Arbeit sehr wichtig sind“, fasste er zusammen.
Was soll der Ausschuss aufklären? Im Wesentlichen geht es um die Frage, ob und wenn ja warum ein bereits geplanter Neubau der Talbrücke, der für das Jahr 2019 gelistet gewesen sein soll, verschoben worden ist. Der zwischen 2017 und 2021 amtierende NRW-Verkehrsminister und heutige Ministerpräsident Hendrik Wüst behauptet, die Verantwortung für die Sperrung der Talbrücke
Rahmede trage die vorherige von SPD und Grünen getragene Landesregierung. Diese Darstellung wird allerdings in Zweifel gezogen. Entgegen der Verlautbarung des Ministerpräsidenten soll die Talbrücke Rahmede nach dem Regierungswechsel 2017 von einem Neubauprojekt zu einem Sanierungsprojekt herabgestuft worden sein.
Diese Entscheidung der Landesregierung soll unmittelbar nach einer Darlegung der Neubauplanung aus der vorherigen Regierungsperiode an den damaligen Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Verkehrsministerium, Dr. Hendrik Schulte, getroffen worden sein.
Die genauen Umstände und Gründe für diese Entscheidung sind bis heute unklar und sollen durch den PUA III geklärt werden.