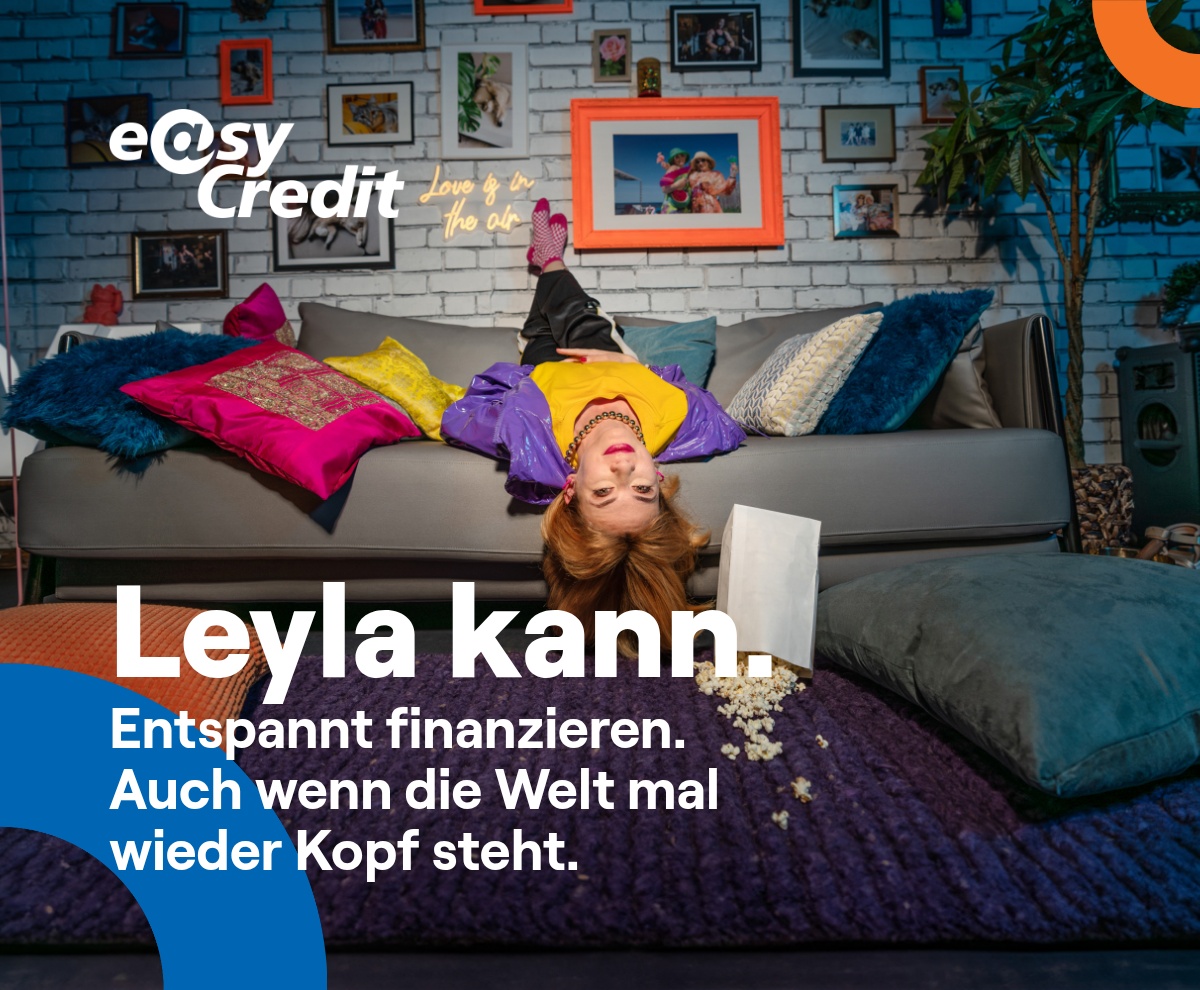Zwischen Ebbekamm, Valberter Ortsmitte und Ebbebach-Tal ist Barbara Schroeders Revier. Anfangs machte sie ihre Runde per pedes, inzwischen fährt sie die gut 7,5 Kilometer mit dem Auto ab. Jetzt, im Herbst, achtet auf den Blattfall bei verschiedenen Bäumen, auf den Fruchtbehang oder notiert, wann der Mais geerntet wird. „Ich verbinde Nützliches mit dem Praktischen“, schätzt sie die Bewegung an frischer Luft und den Nutzwert für den Wetterdienst. Seit 23 Jahren, mit Eintritt in den Ruhestand, ist die ehemalige Biologie-Lehrerin in wissenschaftlicher Mission unterwegs. Rund um Valbert. Was sie sieht fließt in Wetter- und Klimaprognosen mit ein.
„Eine Buche hat die Blätter schon verloren“, hat sie Mitte September beobachtet. Ihre Vermutung: eine Krankheit oder Trockenheit. „Es kann ein Einzelfall sein“, sagt sie. Andere Buchen sind noch grün. Auch Frühäpfel waren schon reif, hat sie beobachtet. Dass bei vielen Kastanien, die sie auch auf ihrer Beobachtungsliste führt, schon „alle sehr verfärbt sind“ und wenig Früchte tragen, führt sie auf den Befall mit einem Schädling zurück: „Miniermotte“, ist sie sich sicher. Bleibt noch der Mais. Wenn der geerntet ist, die Bäume ihre Blätter und die Lärchen die Nadeln verloren haben, hat die Wetterbeobachterin Pause. „Ende Oktober, Anfang November ist Schluss“, weiß Barbara Schroeder aus Erfahrung. Mit den ersten Schneeglöckchen beginnt dann die neue Beobachtungsperiode.
Manchmal reicht Blick aus dem Fenster
Austrieb der Pflanzen, Beginn der Blüte, Reifezeitpunkt, Blattverfärbungen, etwa bei Bäumen. Das sind Kriterien für die Pflanzenbeobachterin. Experten sprechen dabei von „Phasen“. Alles wird mit Datum in Listen eingetragen. Jeweils zum 15. Dezember ist Stichtag. Dann müssen Barbara Schroeder und ihre bundesweit 1050 Kolleginnen und Kollegen ihre Listen einreichen. Unmittelbare Ergebnisse ihrer Arbeit sehen die Phänologen nicht. Zweimal im Jahr flattert ihnen das „Phänologie-Journal“ ins Haus. Darin: Berichte und Beispiele, wofür die Daten gut sind, wie sie ausgewertet werden und in Klima-Modelle einfließen.

Neben Witterung wie Temperatur und Feuchtigkeit spielt auch die Höhenlage eine Rolle. Für Valbert sollte sich die Phänologin auf 425 Metern über NN bewegen. Abweichungen um ca. 50 Meter in beide Richtungen sind möglich. Der DWD gibt die Höhenlagen für seine Beobachter vor.
Unterteilt wird bei den Beobachtungen zwischen Wildpflanzen, Forst- und Ziergehölzen oder landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Aber: Kulturpflanzen scheiden weitgehend aus. Ausgenommen sind Obstgehölze und Sträucher. Da reicht bei Beeren etwa schon mal der Blick aus dem Fenster, um Blüte oder Reife zu beurteilen.
Frühblüher kommen noch früher
Auf einem Kartenausschnitt hat Barbara Schroeder markiert, was sie wo im Visier hat. Am Ebbebach sind es die Erlen. Bei Freisemicke ist es der Mais. Die Futterpflanze wird immer an den gleichen Stellen angebaut. Da lässt sich gut vergleichen, wann er keimt, wann es grün wird auf den Feldern. Dass Winter milder geworden sind und Wettereignisse wie Trockenheit oder Starkregen heftiger geworden sind, haben viele inzwischen realisiert. Frühblüher etwa zeigen sich noch früher. „Schneeglöckchen“, erinnert sich Barbara Schröder, „blühten früher Anfang März, jetzt in geschützten Lagen schon Mitte Januar.“ Insgesamt komme die Vegetation „zehn bis 14 Tage früher“. Wenn es dann nochmal frostig wird, etwa bei der Obstblüte, können die Blüten erfrieren. Die Folge: Ernteausfälle.

„Der Deutsche Wetterdienst (DWD) betreibt seit 1951 ein phänologisches Beobachtungsnetz“, heißt es in einer Pressemitteilung des DWD. Die ehrenamtlichen Beobachterinnen und Beobachter melden von festen Stationen aus nach einheitlichen Richtlinien die Entwicklung der Pflanzen im Jahresverlauf. Mehr als 50 Pflanzen stehen auf der Beobachtungsliste der Valberterin. 14 Stationen steuert sie für die Datenerfassung gezielt an. Manches, wie Hafer, Raps oder Wein hat sie von der Liste gestrichen, weil sie hier kaum vorkommen oder nicht typisch sind. Hilfestellung bei der Beobachtung liefert ein dicker Ordner, den der Wetterdienst seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Darin sind die Merkmale der Pflanzen aufgelistet. Rund 150 Kräuter, Blumen, Sträucher und Bäume umfasst der Katalog.
Neue Aufgabe nach Pensionierung
Manche, wie Schneeglöckchen oder Sal-Weide müssen nur einmal erfasst werden, dann, wenn die Blüte beginnt. Bei Kastanien werden sechs Phasen, also Wachstumsmerkmale, erfasst. Manches ist auch schwer zu bestimmen. Wann etwa ist eine Hagebutte richtig reif? Da ist die Erfahrung der Phänologen gefragt. Barbara Schroeders Messlatte ist hier, „wenn sie weich sind.“
Mit der Pensionierung 2001 war für sie klar: „Ich muss was machen.“ Beim Durchblättern eines Garten-Magazins stieß sie auf eine kleine Anzeige. Der Deutsche Wetterdienst suchte eine Pflanzenbeobachterin. Barbara Schroeder bewarb sich – und wurde genommen. Natur hatte ihr Vater, von Beruf Landwirt, der Tochter schon als Kind nahegebracht. Zudem hatte sie Biologie studiert. „Mein Schwerpunkt war Botanik“, sagt sie. Als Pensionärin konnte sie so Bewegung an frischer Luft beim Rundgang durch Valberts Fluren und ihre botanischen Kenntnisse unter einen Hut bringen. Inzwischen, nicht mehr so gut zu Fuß, fährt sie die Stationen nach dem Einkauf mit dem Auto ab. – „Nützliches und Praktisches verbinden“ halt.
INFO
- Der Begriff „Phänologie“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Lehre von den Erscheinungen“. Er bezieht sich auf regelmäßig wiederkehrende Wachstumserscheinungen in der Natur.
- Phänologen (Pflanzenbeobachter) halten fest, wann bestimmte Wachstumsstufen (Blüte, Fruchtreife, Blattentfaltung oder -verfärbung) eintreten.
- Zum wissenschaftlichen Nutzen heißt es beim Deutschen Wetterdienst: „Es zeichnet sich ab, dass phänologische Daten in Zukunft verstärkt für Trendanalysen zur Klimadiagnostik herangezogen werden, da sich die Eintrittsdaten vieler phänologischer Phasen sehr gut in Beziehung zu Temperatur-Trends setzen lassen.“
- Links: www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimaueberwachung/phaenologie/phaenologie_node.html und www.planet-wissen.de/natur/klima/phaenologie