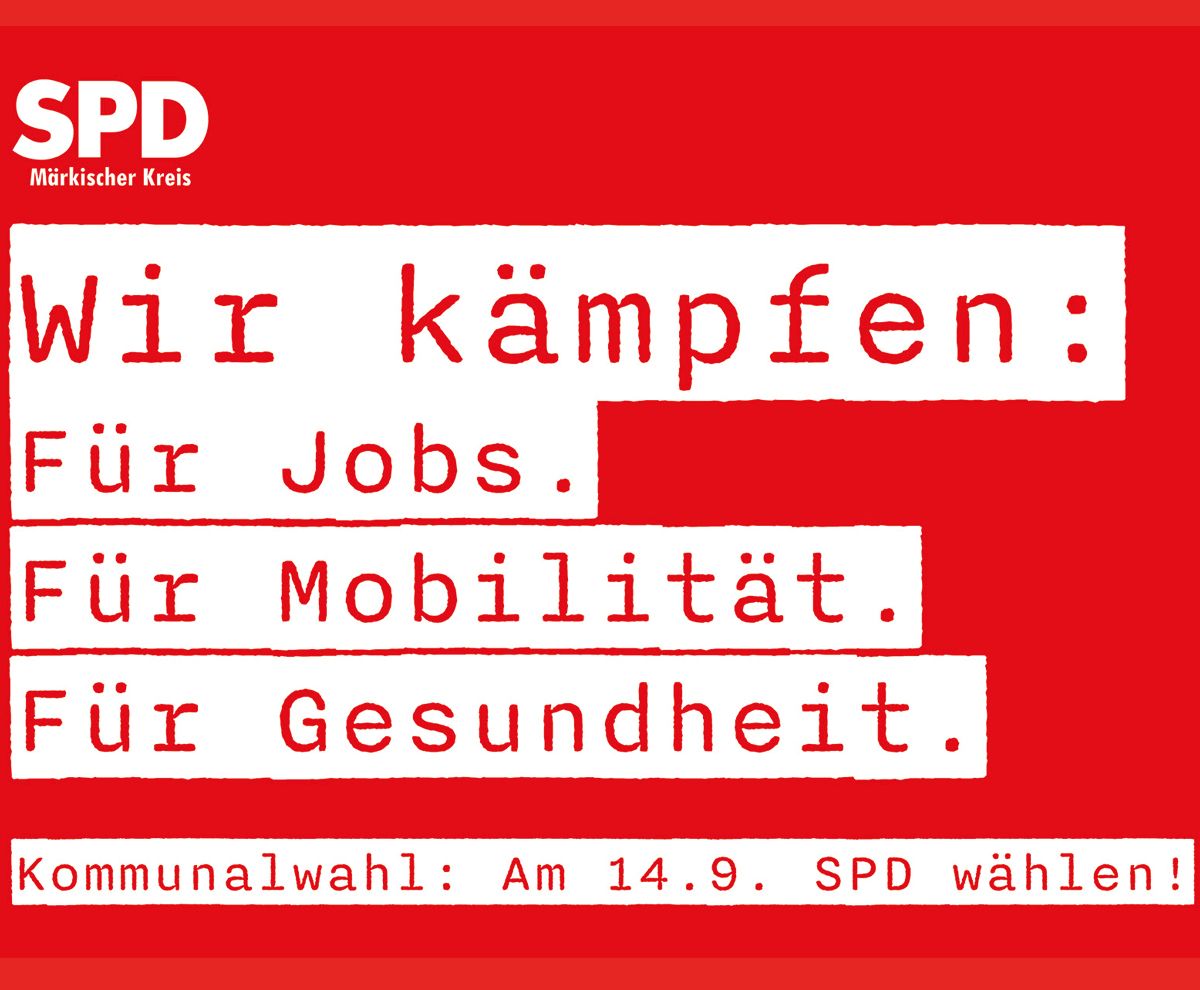Der Wupperverband teilt mit, dass die Wasserabgabe an die Wupper in diesen Tagen angepasst werden musste. Grund ist die "außergewöhnliche Frühjahrsdürre".
Durch die langanhaltende Trockenphase von Februar bis April konnten die Brauchwassertalsperren des Wupperverbandes im Jahr 2025 weniger Wasservorrat für den Sommer einspeichern als üblich. An der Messstelle Bever-Talsperre handelt es sich um die dritttrockenste Periode (Februar, März und April) seit 118 Jahren Datenaufzeichnung an dieser Station. Daher ist insbesondere die größte Brauchwassertalsperre im Wuppergebiet, die Wupper-Talsperre, mit einem niedrigen Füllstand in das Frühjahr gestartet, teilt der Wupperverband mit.
Die Trockenheit habe auch dazu geführt, dass der Wupperverband schon sehr früh im Jahr das Ökosystem Wupper mit Wasser aus der Wupper-Talsperre und den weiteren Brauchwassertalsperren, z. B. der Bever-Talsperre, unterstützen musste. Somit habe die Wupper-Talsperre einen für Anfang Mai deutlich zu niedrigen Füllstand. Aktuell liege der Stauinhalt in der Hauptsperre bei 47 Prozent (11,8 Mio. Kubikmetern). Im Idealfall hätte diese jetzt einen Füllstand von 90 Prozent (22,5 Mio. Kubikmeter). Ein niedriger Füllstand hat, so der Verband, Folgen für das Ökosystem der Talsperre und kann unter anderem zu einer erhöhten Erwärmung, verringerter Sauerstoffverfügbarkeit und dem vermehrten Auftreten von Algenblüten über die Sommermonate führen.
Pegel in Wuppertal: 500 Liter pro Sekunde weniger
Darauf habe der Wupperverband reagiert und ab sofort die Abgabe aus der Wupper-Talsperre an die Wupper maßvoll angepasst. Denn der Wasservorrat müsse – wenn kein ergiebiger Regen fällt – noch Monate ausreichen, um die Niedrigwasseraufhöhung zu ermöglichen.
Die Wupper-Talsperre werde so gesteuert, dass am Pegel Kluserbrücke in Wuppertal nun in Trockenphasen rund 3.000 Liter pro Sekunde fließen statt der bislang festgelegten Mindestwasserführung von 3.500 Litern pro Sekunde.
Der Verband wird die Auswirkungen der verringerten Wasserführung mit einem engmaschigen und umfangreichen Gewässermonitoring begleiten, teilt er weiter mit. Hierzu werde die Wasserqualität an mehreren Messstellen im Gewässerverlauf wöchentlich und an einer besonders relevanten Messstelle mit einer mobilen Messstation kontinuierlich in Niedrigwasserlagen untersucht.
Der Wupperverband werde die Situation der Talsperre intensiv beobachten. Wenn durch weitere Trockenphasen im Laufe der kommenden Monate der Stauinhalt der Wupper-Talsperre – und auch weiterer oberhalb gelegener Brauchwassertalsperren – deutlich absinkt, sei eine weitere Anpassung der Talsperrensteuerung erforderlich.
Aufgaben der Brauchwassertalsperren
Die Brauchwassertalsperren des Wupperverbandes sind Multifunktionsbauwerke mit mehreren Aufgaben. In Trockenzeiten unterstützen die Brauchwassertalsperren – Wupper-, Bever-, Brucher- und Lingese-Talsperre – die Wupper mit Talsperrenwasser. Sie sorgen dafür, dass die Wupper einen Mindestwasserstand hat und nicht austrocknet. Außerdem wird mit dem Talsperrenwasser eine gute Durchmischung in der Wupper gewährleistet, in die unter anderem auch das in den Kläranlagen gereinigte Abwasser abgegeben wird.
Die Niedrigwasseraufhöhung durch die Talsperren ist daher eine wichtige Stütze des Ökosystems Wupper.
Parallel dienen die Talsperren dem Hochwasserschutz. Durch den freien Stauraum in den Talsperren können Regenmengen gepuffert und somit Abflüsse in der Wupper gemindert werden.
In der Wupper-Talsperre zum Beispiel hält der Wupperverband in den Wintermonaten 9,9 Mio. Kubikmeter Stauraum (knapp 40 Prozent in Bezug auf den max. Stauinhalt) als Puffer frei, den sogenannten Hochwasserschutzraum. Im Sommer wird ein Sommerretentionsraum freigehalten. Dieser beträgt an der Wupper-Talsperre 2,5 Mio. Kubikmeter. Bei Bedarf – wenn große Regenmengen angekündigt werden – kann dieser Puffer durch vorherige Abgabe vergrößert werden.