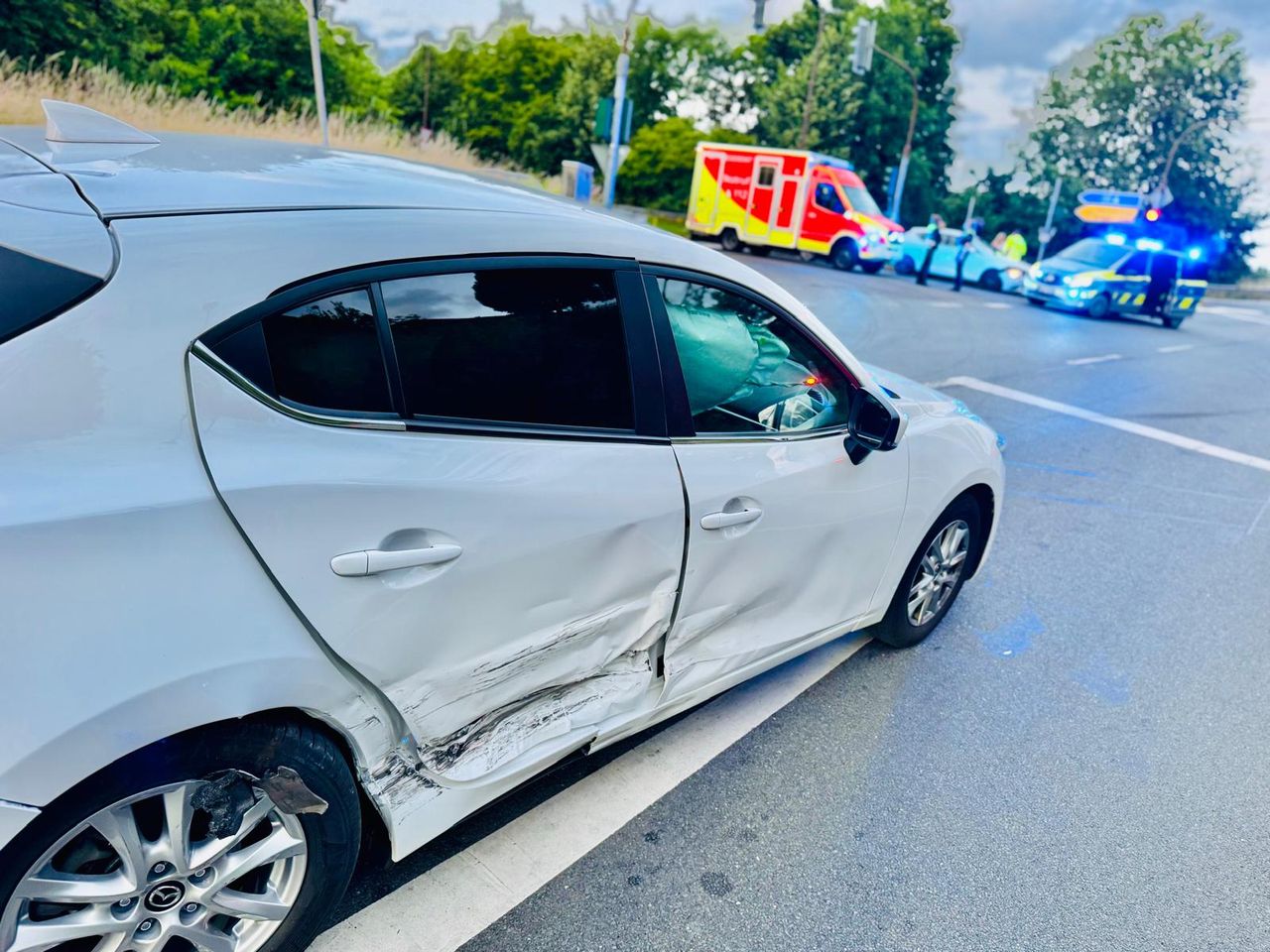Maria, Josef, das Jesuskind und der Verkündigungsengel, gegossen aus einer Mischung von Sand und Zement mit Heiligenscheinen aus Blech, wirken roh, erdverbunden und sprechen den Betrachter auf eine besondere Weise an. Die Figuren überliefern eine Botschaft aus der Nachkriegszeit und erzählen von den Entbehrungen, unter denen nicht nur die Menschen in Hagen lebten.

Das Material verleiht den Figuren eine überzeitliche Aura, sie wirken wie archäologische Fundstücke aus einer Höhle in Bethlehem. Diese archaische Anmutung ist bei Schumacher allerdings mehr als ein Brückenschlag in die Tiefen der Geschichte. Sie ist gleichzeitig Ausdruck eines Bedürfnisses nach expressionistischer Reduktion. Emil Schumacher war damals 35 Jahre alt, selbst junger Vater und ein noch unbekannter Maler, der mit seiner Kunst zum Kern der Dinge durchdringen will.
Schumacher schuf diese Krippe 1947 als Auftragsarbeit eines Pfarrers der Jakobus-Kirchengemeinde in Breckerfeld-Zurstraße. Dort kam sie allerdings nicht an. Der Geistliche lehnte das Werk ab. Vermutlich habe die Gemeinde eine „naturalistisch ausgebreitete Krippe mit Ochs und Esel erwartet“, heißt es im Begleittext .
Die Weihnachtskrippe aus dem Jahr 1947 ist ein besonders persönliches Werk Emil Schumachers, das bisher nur wenigen Hagener Familien vertraut ist. Es existieren lediglich fünf Abgüsse, die sich im Privatbesitz Hagener Familien befinden.

Was zeigt die Krippe? Josef stützt sich auf einen Stab, Maria kauert auf einem Schemel daneben. Ein Säugling – das Jesuskind – liegt auf trockenem Stroh. Und auch der Engel im Hintergrund wirkt alles andere als pompös. Aber es wird deutlich: Er stammt aus einer anderen Welt.
Das Stroh, auf das das Christuskind gebettet ist, stammt noch original aus dem Jahr 1947. Jeder Halm ist vom Künstler eigenhändig arrangiert worden. Hält man sich wiederum mittelalterliche Altarbilder vor Augen, stellt man fest, dass Jesu Körper meist von einer Aureole umgeben ist, einem Strahlenkranz, der aussagt: Der Heiland bringt das Licht in die Welt. Schumachers Anordnung der Halme imitiert einen gemalten Strahlenkranz.

Gleichzeitig sind die Halme in Kreuzform verlegt. Und auch das Kind liegt in einer Haltung auf dem Stroh, wie sie später der Gekreuzigte einnehmen wird. So denkt Emil Schumacher in der Freude über die Geburt den Karfreitag schon mit. Der Heiland blickt übrigens nicht zu seinen Eltern, sondern zum Betrachter. Die Botschaft ist klar: Dieses Kind geht uns alle an.
Die jetzt 76 Jahre alte Krippe hat auch bei Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen einen starken Eindruck hinterlassen. „Ich habe eine Krippe, die so direkt mit dem Betrachter spricht, noch nie gesehen“, sagte sie bei der Vorstellung dieses außergewöhnlichen Schumacher-Werks.

Zur Person: Emil Schumacher wurde am 29. August 1912 als drittes Kind von Anna und Emil Schumacher in Hagen geboren. Von 1926 bis 1931 besuchte er die Oberrealschule in Hagen.
Er studierte einige Semester Werbegrafik an der Handwerker- und Kunstgewerbeschule in Dortmund. Von 1935 bis 1939 war er als freier Maler ohne eine Beteiligung an Ausstellungen tätig. In den Kriegsjahren war er Technischer Zeichner in den Akkumulatoren-Werken, einem Hagener Rüstungsbetrieb. Im Jahr 1941 heiratete er Ursula Klapprott und Sohn Ulrich wurde geboren. Unmittelbar nach Kriegsende startet Emil Schumacher einen Neubeginn als freier Künstler.
1947 hatte er seine erste Einzelausstellung in dem vom Architekten Rasch eingerichteten Studio für neue Kunst in Wuppertal und wurde Mitbegründer der Künstlervereinigung Junger Westen. 1948 erhielt er den Kunstpreis Junger Westen der Stadt Recklinghausen, im selben Jahr kaufte das Karl-Ernst-Osthaus-Museum Hagen zwei seiner Bilder an. In den 1950er Jahren entwickelte er Werke, die nur aus der Farbe lebten, ohne jegliches konstruktives Gerüst. Dominierendes Thema seiner Arbeiten sind die Eigenwertigkeit der Farbe und Farbmaterie.
1954 beteiligte sich Schumacher an der von Willem Sandberg im Stedelijk Museum, Amsterdam veranstalteten Ausstellung Deutsche Kunst nach 45. Dabei wurde zum ersten Mal nach dem Krieg zeitgenössische Kunst aus Deutschland im Ausland gezeigt. Ab 1955 wurde Schumacher durch erste Ausstellungen und Preise bekannt; seine Teilnahme an der 29. Biennale von Venedig 1961 sowie die Verleihung des Guggenheim Award (National Section) bereits 1958 dokumentieren seinen internationalen Durchbruch. Mehrfach war er auch auf der Documenta in Kassel vertreten. Heute hängen seine Arbeiten in vielen wichtigen Museen der Welt. Unter seinen zahlreichen Kunstwerken für den öffentlichen Raum finden sich u. a. großformatige Mosaikarbeiten für die U-Bahn-Station Colosseo in Rom.
Emil Schumacher starb 1999 in San José auf Ibiza. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Hagener Remberg-Friedhof in einem Ehrengrab.
In seiner Heimatstadt Hagen entstand 2006 bis 2009 das Kunstquartier Hagen. Es vereint das Osthaus-Museum und das zu seinen Ehren gebaute Emil-Schumacher-Museum, das 2009 eröffnet wurde. (Quelle: Wikipedia)