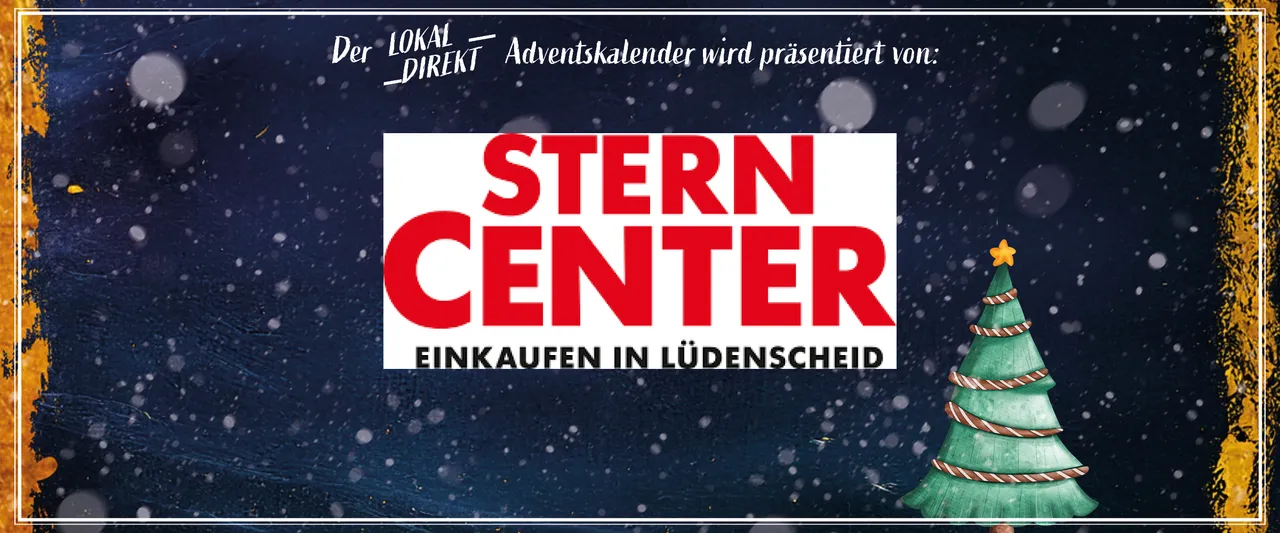Sollen Kranke und Verletzte den Einsatz eines Rettungswagens zukünftig anteilig mitbezahlen? Selbst wenn der Einsatz zwingend nötig war oder bei einer sogenannten Fehlfahrt die Behandlung vor Ort den Krankenkassen weitaus höhere Krankenhauskosten einspart? Die Stadt Lüdenscheid, die als Kommune von den Krankenkassen ebenfalls zur Kasse gebeten werden soll, warnt vor diesem Szenario.
Wer kommt dafür auf, wenn ein Rettungswagen anrückt, einen Patienten aber letztendlich nicht ins Krankenhaus bringen muss? Die Krankenkassen weigern sich, die Kosten für diese sogenannten „Fehlfahrten“ von Rettungsfahrzeugen weiterhin automatisch und vollumfänglich zu übernehmen. Mit der Folge, dass Kommunen solche Rettungseinsätze bezahlen oder aber das Geld dafür bei den Patienten eintreiben müssten. Aber auch bei „regulären“ Rettungsfahrten droht künftig ein Gebührenbescheid. Vor diesem Szenario warnt nicht nur der Städtetag NRW, sondern auch die Stadtverwaltung Lüdenscheid – aus gleich mehreren Gründen.
"Fehlfahrten" sollen den Krankenkassen rückwirkend erstattet werden
Wie die Stadt Lüdenscheid informiert, ging Anfang Oktober ihr ein Schreiben der Krankenkassen ein. Das enthält zum einen die Ankündigung, dass „Fehlfahrten“ von Rettungsdiensten ab sofort und rückwirkend ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr – wie seit Jahrzehnten üblich – automatisch von den Krankenkassen bezahlt werden. Zum anderen sind in dem Schreiben deutlich reduzierte Festbeträge für alle Einsätze von Krankentransporten, Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeugen aufgelistet. Begründung: Die Krankenkassen wollen Kreisen und Kommunen für solche Fahrten weniger Geld zahlen, weil sie die bisherigen Pauschalen als überhöht ansehen.
„Die Festsetzung dieser Beträge lässt leider jegliche Transparenz vermissen“, sagt Fabian Kesseler, Erster Beigeordneter der Stadt Lüdenscheid. „Die Krankenkassen bemängeln, dass wir einen unwirtschaftlichen Rettungsdienst hätten, führen das aber nicht aus. Auch eine Kostenkalkulation fehlt“, so Kesseler weiter. Die Folge für die Stadt: Bei der Abrechnung von Rettungsfahrten nach dem neuen Modell fehlt künftig jedes Mal Geld.
Definition von "Fehlfahrten" fehlt
Auch für Lüdenscheids Feuerwehr-Chef Christopher Rehnert ist der Vorstoß der Krankenkassen nicht nachvollziehbar, denn: „Es gibt keine genaue Definition von Fehlfahrten“, sagt Rehnert. Dass ein Rettungswagen einen Patienten nicht immer ins Krankenhaus befördert, bedeute nicht, dass der Einsatz unnötig gewesen sei. Im Gegenteil: „Wenn der Einsatz vor Ort erfolgreich war und ein Patiententransport deswegen nicht mehr nötig ist, werden die Krankenhäuser und damit das gesamte Gesundheitssystem doch entlastet.“ Und das Wichtigste: „Menschen, die auf ärztliche Hilfe angewiesen sind, muss im Notfall schnell und unkompliziert geholfen werden“, so Rehnert.
Genau diese Selbstverständlichkeit sieht die Stadtverwaltung jetzt durch die neuen Pläne der Krankenkassen bedroht. Die reduzierten Festbeträge für Rettungsfahrten führen dazu, dass den Kommunen Kosten entstehen, die sie aufgrund der ohnehin schwierigen Haushaltssituation unmöglich stemmen können. Ebenso wenig können Städte und Gemeinden für „Fehlfahrten“ aufkommen. Der Stadt Lüdenscheid etwa droht allein für das Jahr 2025 ein Verlustrisiko von rund drei Millionen Euro.
Patienten müssten in Vorkasse gehen
Die Folge: Die Kommunen wären dazu gezwungen, für jede „Fehlfahrt“ – bei ausstehender Definition – Gebührenbescheide an die betroffenen Patienten zu verschicken. Die Patienten wiederum müssten in Vorkasse gehen und sich das Geld selbst bei den Krankenkassen zurückholen. Weil ihnen allerdings nur der reduzierte Festbetrag erstattet würde, müssten sie die verbleibende Differenz aus eigener Tasche zahlen. Die Spannweite reicht hier je nach Einsatzart von rund 180 bis hin zu 425 Euro. Das entspricht jeweils rund einem Drittel der Transportkosten.
Auch Einsätze, bei denen der Patient tatsächlich ins Krankenhaus transportiert wird, würden einen Gebührenbescheid nach sich ziehen. Die Differenz zwischen den reduzierten Festbeträgen für Kreise und Kommune, die die Krankenkassen ansetzen, und der tatsächlichen Gebühr müssten Patienten nämlich ebenfalls aus eigener Tasche zahlen. Auch das entspräche jeweils rund 33 Prozent der Kosten.
Dramatische Folgen möglich
„Das wäre ein immenser bürokratischer Aufwand für alle Beteiligten und außerdem äußerst kompliziert“, sagt Fabian Kesseler. Vor allem sieht der Erste Beigeordnete aber die Gefahr, dass Menschen im Notfall aus Sorge vor möglicherweise auf sie zukommenden Kosten nicht oder zu spät den Rettungsdienst anfordern – mit schlimmstenfalls dramatischen Folgen für auf Hilfe angewiesene Patienten.
„Da muss jetzt dringend etwas passieren“, fordert Kesseler. „Das ist ein Thema, das die Kommunen und vor allem die Patienten enorm belastet, während Bund und Länder von der Ersatzbank aus zuschauen und die Krankenkassen ihre Patienten allein und im Ungewissen lassen.“
Bund und Land müssen eine Lösung finden
Der Städtetag NRW hat die Landesregierung bereits dazu aufgefordert, die Krankenkassen an den Verhandlungstisch zurückzuholen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Notfalls müssten die Kosten für sogenannte „Fehlfahrten“ aus Landesmitteln finanziert werden, weil das Land für das Rettungswesen zuständig sei, argumentiert der Städtetag. Fabian Kesseler bringt eine weitere Option ins Spiel: „Der Bund könnte in den Regelungen zur gesetzlichen Krankenversicherung gesetzgeberisch festhalten, dass das, was seit Jahrzehnten galt und nun von den Kassen in Abrede gestellt wird, weiterhin gilt.“
Die Stadt Lüdenscheid beobachtet die Entwicklung ganz genau. In nächster Zeit wird die Verwaltung, sofern die Pläne der Kassen überhaupt Realität werden, noch keine Gebührenbescheide verschicken.