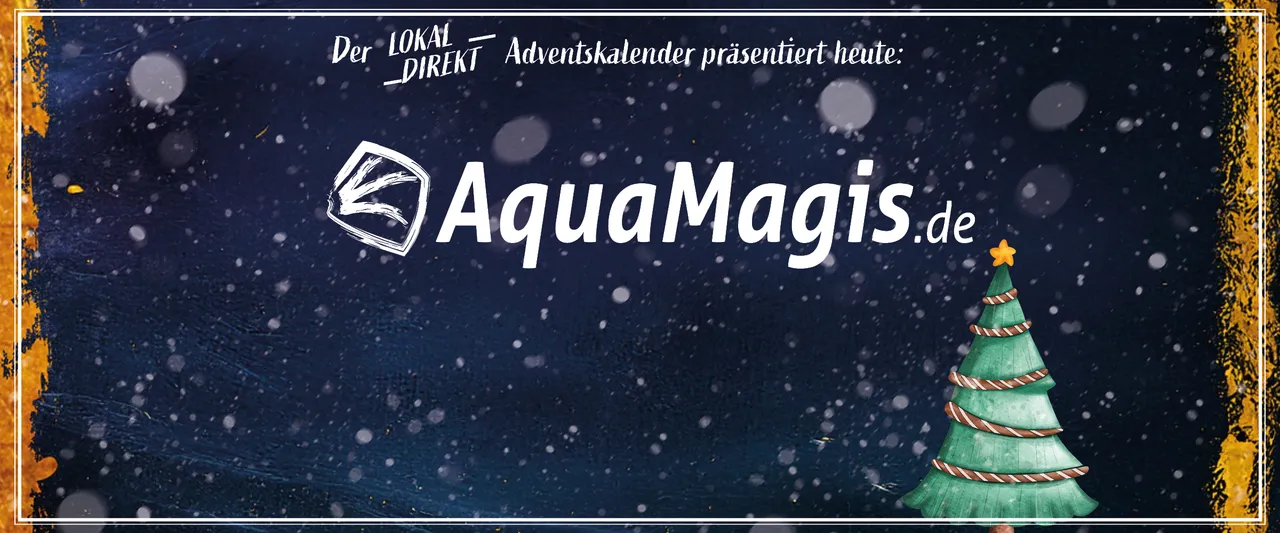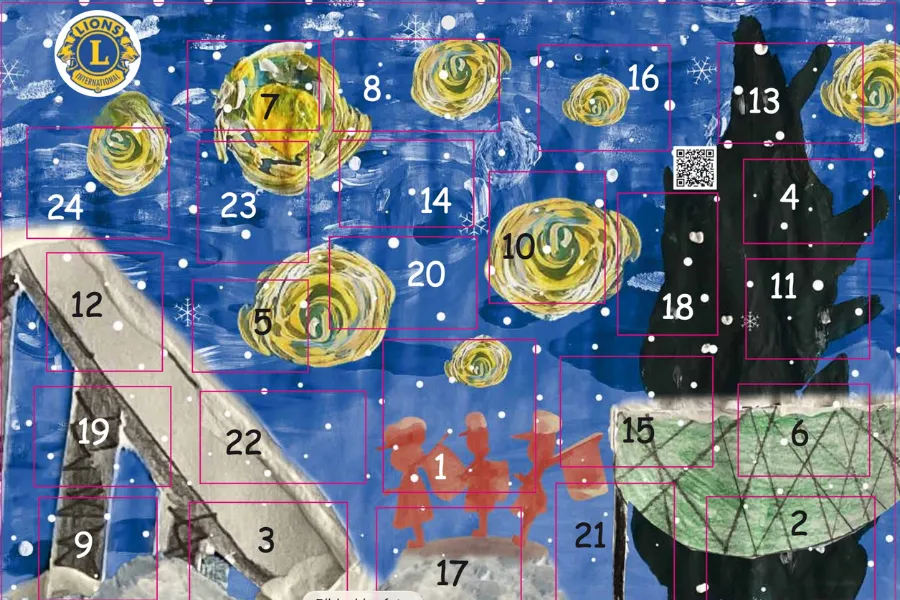„Den Super-Baum gibt es leider nicht“, sagt Christof Schäfer. Auch er als Experte kann nicht mit Sicherheit sagen, welche Aufforstungsmethode zum Erfolg führt. Fichtenwälder wie bisher werde es sicherlich so nicht mehr geben. Dennoch, ganz verteufeln will der Experte den Nadelbaum nicht. Er sei schnellwachsend und eigentlich leicht im Handling. Zudem müsse es nach wie vor bezahlbares Holz geben. „Hier und da gibt es Naturverjüngung mit Fichten. Da würde ich jetzt auch nichts gegen machen und sie kommen lassen“, sagt der Experte. Allerdings nicht, wenn die Bäume auf exponierten Kuppenlagen wachsen. Dort seien die Risiken, wie die Vergangenheit gezeigt habe, einfach zu groß.
„Das Thema Aufforstung ist wirklich schwierig“, sagt Christof Schäfer. Die Witterung sorge für große Probleme. Auf Flächen, die bereits im Frühjahr aufgeforstet wurden, gibt es erhebliche Ausfälle. „Erst war es noch gut nass. Doch schon im April wurde es trocken. Das haben viele junge Pflanzen nicht verkraftet“, berichtet Schäfer. Im Herbst gehe es mit den Aufforstungsmaßnahmen weiter. „Richtig intensiv aber vermutlich erst im kommenden Frühjahr“, sagt der Förster. Derzeit seien die Waldarbeiter mit den Läuterungen der Kyrill-Flächen beschäftigt. Das ist ein sogenannter waldbaulicher Eingriff in Aufwüchse und Dickungen zur Entnahme unerwünschter Baumarten oder schlecht geformter, kranker oder unterdrückter Stämme.
Nicht jede Fläche wird aufgeforstet
Kyrill habe gezeigt, wie schnell sich die Natur erholen kann und Flächen wieder zuwachsen. „Es werden sicherlich nicht alle Waldbesitzer jetzt wieder aufforsten. Bei manchen ist es finanziell einfach überhaupt nicht möglich“, sagt Schäfer. Einige hätten durch den Borkenkäfer nahezu alles verloren. „Die Erträge hat der eine oder andere anders investiert. Wald ist ja auch immer ein Generationenvertrag. Sprich, was ich jetzt pflanze, ernte ich frühestens in 30 oder 40 Jahren. Das möchte einfach nicht jeder“, erklärt Schäfer. Andere Waldbesitzer warten erst einmal ab, was andere machen und mit welchen Maßnahmen Erfolge erzielt werden. „Ich gehe schon davon aus, dass noch einige im Nachhinein etwas machen möchten“, sagt der Förster. Und es gebe auch viele, die bereits aktiv geworden seien und die Erlöse aus dem Käferholz direkt in Anpflanzungen investiert hätten.
Auf den neuen Flächen setzen die Waldbauern vor allem auf Vielfalt. „Diese intensiven Pflanzverbände mit 2500 bis 3500 Fichten pro Hektar, das ist vorbei“, sagt Schäfer. Die Fichte sei allerdings nach wie vor gut auf Flächen, die massiv zur Verkrautung neigen. Einige Waldbesitzer testen jetzt auch einige exotischere Bäume. Schäfer selbst probiert auch einiges: „Wir machen schon einige Experimente. Wir haben Flächen mit Walnüssen, Baumhasel, Esskastanie und anderen Nadelhölzern. Wir sind jedoch etwas verhaltener in der Extravaganz. Es geht ja schließlich um das Geld der Waldbesitzer.“ Vor allem mit der Entwicklung der Esskastanie sei er sehr zufrieden: „Die wachsen schnell und gut. Bis jetzt sieht das wirklich vielversprechend aus.“

Grundsätzlich hätten aber alle Pflanzen irgendwelche Probleme. Das sehe man aktuell ganz gut bei der Douglasie. Auf die setzten viele Waldbauern nach Kyrill. „Die Douglasie hat immer mal wieder Probleme mit Nadelparasiten und Pilzen. Sie sterben davon zwar nicht ab, aber sie leiden darunter und entwickeln sich dann nicht so wie gewünscht.“ Wie schnell Flächen wieder grün werden, zeige sich aktuell bereits. Viele Hänge, die nach den Kahlschlägen im Frühjahr noch braun waren, sind von Weitem bereits wieder grün. „Im kommenden Frühjahr werden wir ganz viele pinke Felder bekommen. Der Fingerhut ist eine Pionierpflanze. Bevor es richtig grün wird, wird es also erst einmal richtig pink“, erklärt Christof Schäfer.